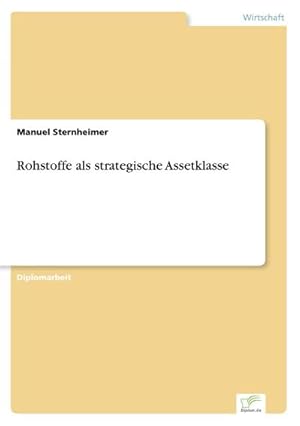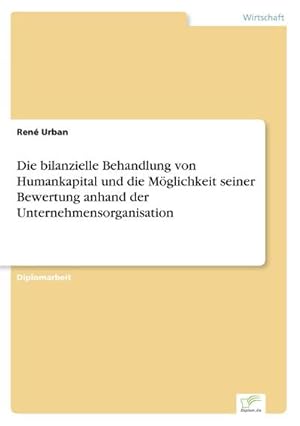diplom de dez 2006 (51 results)
Search filters
Product Type
- All Product Types
- Books (51)
- Magazines & Periodicals (No further results match this refinement)
- Comics (No further results match this refinement)
- Sheet Music (No further results match this refinement)
- Art, Prints & Posters (No further results match this refinement)
- Photographs (No further results match this refinement)
- Maps (No further results match this refinement)
- Manuscripts & Paper Collectibles (No further results match this refinement)
Condition
- All Conditions
- New (51)
- Used (No further results match this refinement)
Binding
- All Bindings
- Hardcover (No further results match this refinement)
- Softcover (51)
Collectible Attributes
- First Edition (No further results match this refinement)
- Signed (No further results match this refinement)
- Dust Jacket (No further results match this refinement)
- Seller-Supplied Images (51)
- Not Print on Demand (12)
Free Shipping
- Free Shipping to U.S.A. (No further results match this refinement)
Seller Rating
-
Auswahl mit Variantenvergleich, Planung und produktionswirksame Einführung eines Verfahrens zur Verschlüsselung von externen Mails in der Berliner Volksbank
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600617 ISBN 13: 9783836600613
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 76 pp. Deutsch.
-
Anforderungen an eine nachhaltige Anreizregulierung der Netzentgelte für die deutsche Elektrizitätswirtschaft
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600455 ISBN 13: 9783836600453
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Energiewissenschaften, Note: 2,0, Universität Hamburg (Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Statistik und Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Die Marktstruktur der deutschen Elektrizitätswirtschaft im Jahr 2006 ist durch horizontale Konzentration auf der Erzeugungsebene und vertikale Integration über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen gekennzeichnet. Durch die Fusionstätigkeit nach der Liberalisierung 1998 hat die Konzentration zugenommen. Die Zahl der überregionalen Verbundunternehmen hat sich durch Unternehmenszusammenschlüsse von acht auf vier reduziert. Der deutsche Strommarkt wird von RWE, E.ON, Vattenfall Europe und EnBW oligopolistisch beherrscht. Zusammen verfügen sie über 80 Prozent der deutschen Erzeugungskapazitäten für elektrische Energie. Zudem kontrollieren sie über vertikale Beteiligungen an regionalen Versorgern und lokalen Stadtwerken auch den Absatz von Elektrizität.Die Kombination aus dem privatwirtschaftlich verhandelten Netzzugang mit Ex-post-Kontrolle und der ausgeprägten vertikalen Verflechtung der Netzunternehmen führte zu Diskriminierungsanreizen der Netzbetreiber auf den nachgelagerten Ebenen. Der Gesetzgeber sah hierin die hauptsächliche Ursache für die hohen Netzzugangsentgelte und Strompreise sowie den fehlenden Wettbewerb zwischen etablierten Betreibern und neu in den Markt eintretenden Stromanbietern. Die niedrige Wettbewerbsintensität in Verbindung mit hohen Strompreisen veranlasste den Gesetzgeber, mit der Energierechtsnovelle vom 13. Juli 2005 den zukünftigen Verlauf einer disaggregierten Regulierung festzulegen. Dabei soll ausschließlich der Netzbetrieb reguliert werden. Der diskriminierungsfreie Zugang zur Netzinfrastruktur ist die Voraussetzung für Wettbewerb auf den anderen Stufen des Elektrizitätsmarktes.Drei Kernpunkte des neugeregelten Energiewirtschaftsrechts sind von besonders weitreichender Bedeutung. Der disaggregierte Regulierungsansatz unterscheidet die zu regulierenden Netzebenen von den wettbewerbsfähigen Stufen der Wertschöpfungskette. Das zum Jahr 2007 umzusetzende legal Unbundling, d.h. die gesetzlich verordnete Entflechtung der operationellen Organisationseinheiten Energieerzeugung, Übertragungs- und Verteilungsnetzbetrieb sowie Vertrieb für Unternehmen mit mehr als 100.000 Kunden, soll die Möglichkeit zur Quersubventionierung durch künstlich überhöhte Netznutzungsentgelte der bisher vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen (EVUs) unterbinden.Ein zweiter Kernpunkt des neuen Energiewirtschaftsgesetzes ist die Einrichtung einer Marktaufsicht. Die Bundesnetzagentur soll die Netzbetreiber auf dem deutschen Energiemarkt überwachen und für ein angemessenes Preisniveau sorgen. Zur Ermöglichung einer solchen Aufsicht erlegt das Gesetz den Versorgungsunternehmen umfangreiche Veröffentlichungs-, Dokumentations-, Berichts- und Auskunftspflichten auf.Das Thema dieser Arbeit ist der dritte Punkt, die noch auszugestaltende Anreizregulierung der Netznutzungsentgelte. Diese Entgelte machen ca. ein Drittel des Strompreises aus. Im Energiewirtschaftsgesetz ist der gesetzliche Rahmen für eine anreizbasierte Entgeltregulierung vorgegeben. Die Bundesnetzagentur hat zum 1. Juli 2006 den Vorschlag eines möglichen Anreizregulierungssystems vorgelegt. Nach der abschließenden Festlegung der Kalkulationsmethoden für die Netznutzungspreise durch die Bundesregierung werden Netzbetreiber und Verbundunternehmen wichtige Entscheidungen hinsichtlich ihrer Kalkulationen und Investitionen treffen müssen. Schon jetzt sind die Voraussetzungen für eine [.] konstante Entwicklung stabile Märkte, regulatorische Konsistenz, Investitionssicherheit nicht mehr gegeben. Der deutsche Kraftwerkspark und die Energienetze sind veraltet und benötigen Investitionen.Die zukünftige Bedeutung der Energieträger Kohle. 112 pp. Deutsch.
-
Analyse der Stahlbranche
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600390 ISBN 13: 9783836600392
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 2,0, Justus-Liebig-Universität Gießen (Wirtschaftswissenschaften), Veranstaltung: Unternehmensführung und Organisation, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die Nachfrage nach Stahl ist ungebrochen, die Werke sind ausgelastet und die Preise steigen wieder kurz gesagt, die Stahlbranche kocht. Oder kocht sie sogar schon wieder über Stahl war lange Zeit alles andere als eine Industrie, die die Fantasie von Anlegern beflügelte. Früher hätten wir für Stahl eher einen Malus bekommen, zurzeit würden wir einen Bonus kriegen, und in drei Jahren wird das alles wieder ganz anders aussehen. Diese Aussage des Stahlunternehmers Jürgen Großmann als Antwort auf die Frage nach einem eventuellen Börsengang im März dieses Jahres macht auf die Zyklen der Branche, aber auch auf deren Rohstoffabhängigkeit aufmerksam. Die Problematik der Stahlbranche besteht aber auch darin, dass sie im Gegensatz zu ihren Rohstofflieferanten und ihren Kunden noch sehr zersplittert ist. Das nun mit Abstand größte Stahlunternehmen der Welt, welches nach einem erbitterten, monatelangen Kampf durch den Zusammenschluss der Unternehmen Mittal und Arcelor hervorgeht, wird die Konsolidierung laut Branchenexperten aber eher noch weiter anfachen, statt diese zu beenden, da das neue Unternehmen ArcelorMittal nun fast viermal so groß ist wie die nachfolgenden Konkurrenten, die dadurch in Zugzwang geraten.Gang der Untersuchung:Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob eine weitere Konsolidierung, und damit eine geringere Schwankungsanfälligkeit und Rohstoffabhängigkeit, unumgänglich für die Stahlbranche sein wird. Die Zielsetzung dieser Arbeit beinhaltet auch die Frage, ob die Branche auf der einen Seite aus großen Big Playern und auf der anderen Seite aus kleinen Nischenanbieter bestehen wird, die den Markt bestimmen und dadurch auch erfolgreicher agieren, als dies Stahlunternehmen mit einer nur mittleren Größe tun. Nach einem einleitenden Überblick über die Stahlbranche in Kapitel 2 werden im nachfolgenden Kapitel 3 zuerst verschiedene Einflussfaktoren der Umwelt, welche die Stahlbranche tangieren, behandelt. Danach wird in Kapitel 4 die Stahlbranche im Hinblick auf ihre Wettbewerbskräfte untersucht, wobei das Hauptaugenmerk auf die vorhandenen Wettbewerber gerichtet ist. Im sich daran anschließenden Kapitel 5 werden verschiedene Wettbewerbsstrategien vorgestellt und auf die Stahlbranche übertragen. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick in Kapitel 6.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis1.Problemstellung12.Die Stahlindustrie im Überblick22.1Herstellung, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Stahl22.2Entwicklungen auf dem globalen Stahlmarkt43.Analyse der Umwelt der Stahlindustrie93.1Theoretische Grundlagen93.2Einflussfaktoren auf den Stahlmarkt124.Analyse der Branche164.1Theoretische Grundlagen164.2Struktur und Dynamik der Stahlbranche204.3Abnehmer und Zulieferer234.4Vorhandene Wettbewerber264.5Potenzielle Konkurrenten und Ersatzprodukte334.6Wettbewerbskräfte im abschließenden Überblick355.Wettbewerbsstrategien und Rendite365.1Theoretische Grundlagen365.2Strategische Gruppen405.3Ergebnisse für die Stahlbranche456.Schlussbetrachtung und Ausblick49Literaturverzeichnis51Textprobe:Textprobe:Kapitel 4.1, Theoretische Grundlagen: Nach der Analyse der allgemeinen Umwelt, auf die die Unternehmen einer Branche keinen direkten Einfluss ausüben können, wird nun die Branche selbst, innerhalb derer die Unternehmen sehr wohl einen Einfluss auf deren Struktur haben, näher betrachtet. Wie im vorangegangenen Kapitel auch, werden zunäc. 84 pp. Deutsch.
-
Guideline for the Development of Chinese Suppliers
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600129 ISBN 13: 9783836600125
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Inhaltsangabe:Abstract:Nowadays companies all over the world face global competition. Because the bought-in part cost of engineering goods represents a big share of the overall production cost of engineering goods, procurement developed to be a major leverage to save cost in the recent years. As part of it, the supplier management is increasingly considered to be an important business function. Further, the development of supply bases in low-cost-countries (LCC), as China is, over the past years rapidly gained significance, since it is one of the remaining levers to reduce costs. After years of mass production of mostly simple products, today Industrialized-Country (IC) companies from the mechanical engineering industry strive for the sourcing of bought-in parts from Chinese suppliers.The scope of this thesis is to examine the existing methods, especially the Balanced Scorecard (BSC), and other concepts of supplier development and supplier improvement for their application with Chinese suppliers. Based on the strengths and weaknesses of these approaches a new procedure is developed. Therefore the first step is the examination of the supplier development process theoretically and practically. The theoretic view is based on literature research while the source for the examination of the practical problems of German buyers as well as of Chinese suppliers is a questionnaire based interview study among involved companies.Generally occurring threats of the buyer supplier relationship should be analyzed and weighed upon their relevancy especially for the Chinese supply market. Taking these issues into account, the existing procedures for supplier development and improvement are optimized for their application to Chinese companies. Finally the thesis closes with a general risk examination and the development of an applicable FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) based methodology for the assessment of purchasing risk especially in China.IC companies penetrating the Chinese market with the target to source locally have to develop a supply base first. The supplier development identifies the required suppliers, assesses them upon their capabilities and establishes a co-operation. A successful supply needs supplier improvement, since fundamental capabilities are lacking frequently. Further, risks weigh heavier due to the high investments required in advance. Considering mainly small and medium sized enterprises in investment goods industry, the [¿] 116 pp. Englisch.
-
Messung der Markenstärke von Retail Brands
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600234 ISBN 13: 9783836600231
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,7, Universität zu Köln (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre), Veranstaltung: Handel und Distribution, Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die vorliegende Arbeit ist der Erforschung des Markenphänomens bei Handelsunternehmen gewidmet. In der Literatur finden sich zahlreiche Untersuchungen, die sich mit dem Bereich Marke und Markenwert beschäftigen, jedoch sind diese Studien im Wesentlichen auf Produktmarken ausgerichtet. Zunehmend versuchen Handelsunternehmen aber in den letzten Jahren, das von der Konsumgüterindustrie erfolgreich angewendete Konzept der Markenpolitik auf ihre eigenen Verkaufsstellen zu übertragen, um sich so von der Konkurrenz abzugrenzen.Als Marken des Handels sollen bei dieser Betrachtung seine Verkaufsstellen bzw. aus Sicht der Konsumenten deren Einkaufsstätten verstanden werden. Für diese strategische Ausrichtung des Handels als Marke (Retail Brand) hat sich in Theorie und Praxis der Begriff des Retail Branding etabliert. Die Verknüpfung mit der Markenwertforschung in diesem Bereich ist jung und noch nicht ausgiebig erforscht. Die verhaltenswissenschaftliche bzw. konsumentenorientierte Sichtweise des Markenwerts eignet sich besonders gut zur Markensteuerung und zur Wahrung der Markenkontinuität, da Informationen über die Einstellung und das Verhalten der Konsumenten gewonnen werden können.Grundlegend für das weitere Verständnis ist, dass der Wert einer Marke nicht in dem Unternehmen selbst liegt, sondern in den Köpfen der Konsumenten. Für die Erforschung dieser nicht direkt beobachtbaren Variablen, sogenannte hypothetische Konstrukte oder latente Variablen, und der Wirkungszusammenhänge haben sich Strukturgleichungsmodelle zu einem Quasi-Standard in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und speziell in der Marketingforschung entwickelt.Zur Analyse von Strukturgleichungsmodellen stehen zum einem kovarianzbasierte Verfahren (mit der Software LISREL, AMOS oder EQS) und zum anderen varianzbasierte Verfahren wie der Partial-Least-Squares-Ansatz (mit der Software LVPLS, SmartPLS, PLS-Graph, SPAD-PLS oder PLS-GUI) zur Verfügung. Beide Verfahren wurden in der deutschsprachigen Marketingliteratur unter dem Begriff der Kausalanalyse eingeführt, wobei dem PLS-Ansatz lange Zeit wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Kovarianzstrukturanalyse bzw. der LISREL-Ansatz wird vornehmlich zur Analyse reflektiver Messmodelle eingesetzt und hat in der Vergangenheit oft zur Fehlspezifikation von Messmodellen geführt, indem formative Messmodelle reflektiv behandelt wurden. So haben Veröffentlichungen zu Fehlspezifikationen reflektiver Messmodelle dazu geführt, dass das PLS-Verfahren im deutschsprachigen Raum eine Renaissance erfährt.Der von Herman Wold entwickelte PLS-Ansatz zur Analyse von Strukturgleichungsmodellen stellt einen alternativen Ansatz zur Überwindung dieser Messproblematik dar. Das PLS-Verfahren bietet vielfältige Möglichkeiten bei der Modellierung formativer und reflektiver Konstrukte an und kommt aus diesem Grunde zum Einsatz. Außerdem wird der in der Marketingforschung erhobenen Forderung, den Einflussfaktoren der behandelten Konstrukte mehr Aufmerksamkeit zu schenken, in der vorliegenden Untersuchung nachgekommen.Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage und einem Artikel von Arnett et al. besteht die generelle Zielsetzung der Arbeit ein Instrument zur Messung der Markenstärke von Retail Brands mit Hilfe des PLS-Verfahrens zu entwickeln. Folgende zentrale Fragestellungen sollen im Laufe der Arbeit geklärt werden: Welche strategische Bedeutung kommt dem Retail Branding als strategische Markenpolitik des Handels zu Welche empirischen Ergebnisse zur Markenstärke von Retail Brands aus Kons. 92 pp. Deutsch.
-
Emotionale Kundenbindung
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600536 ISBN 13: 9783836600538
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,3, Beuth Hochschule für Technik Berlin (Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Die Produkt- und Programmpolitik war in der Vergangenheit stark auf die Gewinnung neuer Kunden fokussiert. In der heutigen Zeit jedoch findet die Kundenorientierung immer mehr Anerkennung und gewinnt an Bedeutung. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kunden zum Teil erst nach mehrjähriger Geschäftsbeziehung Gewinne für ein Unternehmen erbringen, da die Akquise von Neukunden oft mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Aufgrund dieser Tatsache stellen heute viele Unternehmen die Kundenzufriedenheit und die Kundenbindung in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensgrundsätze. Gerade in Zeiten, in denen sie verstärktem Wettbewerbsdruck unterliegen, erweist es sich als existentiell, bestehende Kundenbeziehungen nachhaltig zu festigen. Nur eine enge Bindung der Kunden an das eigene Unternehmen bietet optimalen Schutz vor Verdrängungsmaßnahmen der Konkurrenten. Mit dem Entschluss zur Kundenorientierung beweisen die Unternehmen nicht nur, dass sie die entscheidende Rolle ihrer Kunden für die Existenz und den Erfolg des Unternehmens erkannt haben, sondern, dass sie auch bereit sind, das Ziel der Kundenbindung mit geeigneten modernen Kommunikations- und Werbemaßnahmen umzusetzen. Vor allem Dienstleister müssen versuchen neue Strukturen und Kundenbindungsstrategien zu entwickeln, um markt- und kundennäher ausgerichtet zu sein und um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern und steigern zu können. Dabei nehmen bei der Entwicklung dieser Maßnahmen Begriffe wie Emotionalität, Sympathie und Bilder einen zunehmend wichtigeren Stellenwert ein. Diese neuen Ideale sind längst Gegenstand kommerzieller Angebote geworden und gelten vor allem im Bereich der Werbung als Erfolgsfaktoren im globalen Wettbewerb. Ihre Besonderheiten liegen vor allem in der emotionalen Positionierung des Unternehmens bei den Ziel- und Kundengruppen durch eine wirksame pro-aktive Werbe- und Kommunikationsstrategie.Gerade der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), als Teil dieses Dienstleistungssektors, zeichnen sich traditionell durch einen hohen Grad an Kundennähe aus. Die umweltorientierte Verkehrspolitik des ÖPNV in Berlin wird zwar durch die Berliner Bevölkerung gelobt, trotzdem führt diese Erkenntnis in der Realität oftmals noch nicht unbedingt zum Umsteigen vom Pkw auf den ÖPNV. Zum großen Teil liegen die Ursprünge dieser Problematik auf emotionaler Ebene. Leider weist der ÖPNV an vielen Stellen ein Imageproblem auf. Häufig werden mit dem ÖPNV negative Eigenschaften assoziiert, da die Menschen zum Pkw oft noch eine höhere emotionale Bindung haben. Viele sehen zum Auto schlichtweg keine zumutbare Alternative und sind der Ansicht, Bus und Bahn seien zu teuer, unsympathisch und nicht attraktiv genug. Daraus resultiert die zentrale Fragestellung, wie es den Berliner Verkehrsbetrieben trotzdem gelingen kann, Stammkunden nachhaltig und dauerhaft an sich zu binden und neue Kunden zu gewinnen, um eine kontinuierliche Verlagerung der Verkehrsanteile vom motorisierten Individualverkehr (MIV) hin zum ÖPNV zu erreichen. Dazu bedarf es nicht nur einer zukunftsorientierten Betrachtungsweise, sondern auch innovativer und origineller Image-, Kommunikations- und Kundenbindungsstrategien. Die folgende Arbeit führt eine mögliche Strategie auf und soll aufzeigen, inwieweit durch die Implementierung eines Sympathieträgers (Schlüsselbildes) die Dachmarke BVG gestärkt werden kann. Ziel ist es, das gegenwärtige Image der BVG durch den Einsatz integrierter emotionaler Bildkommunikation zu verbessern. Dabei soll aufgezeigt werden, wie die Dienstleistung ÖPNV in Berlin imagefördernd beworben . 100 pp. Deutsch.
-
Chinas Beitritt in die Welthandelsorganisation
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600021 ISBN 13: 9783836600026
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Sonstiges, Note: 1,0, Leibniz Akademie Hannover - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hannover (Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Der Beitritt Chinas in die WTO am 11. Dezember 2001 hat in den letzten Jahren wie kaum ein anderes Thema zu Spekulationen und Diskussionen geführt. Dies betrifft insbesondere die Auswirkungen in China und die gesamtweltwirtschaftliche Entwicklung. Optimisten sehen die Chance eines durch China geöffneten, gigantischen neuen Weltmarktes und dadurch resultierend gepuschten weltweiten Aufschwungs. Sie versprechen sich anhaltendes wirtschaftliches Wachstum nicht nur in China und den angrenzenden Regionen sondern auch in führenden Industrienationen wie den USA und der EU. Pessimisten verweisen auf die Gefahren eines übermäßigen Wachstums, der einhergehenden ungesunden strukturellen Entwicklung wie der Einkommensverteilung in China und die Gefährdung deutscher Arbeitsplätze. Sie befürchten eine Überschwemmung der Märkte durch importierte, preiswerte chinesische Produkte und schlimmstenfalls ein Kollabieren des chinesischen Systems mit katastrophalen Folgen für die Weltwirtschaft. Die vorliegende Abschlussarbeit gibt einen Überblick der Wirtschaftsgeschichte Chinas, der Handelsabkommen und der Entwicklungen in ausgewählten Industriezweigen seit dem Beitritt in die WTO, um die oben genannten Thesen besser beurteilen zu können.In Kapitel 2 wird die historische Entwicklung und die für den WTO Beitritt relevante Phase der Reform- und Öffnungspolitik Chinas dargestellt. Dieser Abschnitt dient zum besseren Verständnis, welche Politik die chinesische Regierung bei wirtschaftlichen Fragen verfolgt. In Kapitel 3 werden die globalen Handelsabkommen GATT und die WTO vorgestellt. Diese haben für China und seine Handelspartner bei fortschreitendem Handel, wirtschaftlichen Wachstum und Liberalisierung eine immer stärkere Bedeutung. In Kapitel 4 wird erläutert, wie sich einzelne Wirtschaftsbereiche bis zum Beitritt in die WTO in China entwickelt haben und welche Konsequenzen sich durch den Beitritt in die WTO für China und ausländische Handelspartner zumindest theoretisch ergeben. Im Anschluss wird in Kapitel 5 dargestellt, inwieweit der WTO Beitritt zu den erwarteten Veränderungen führte und welche Zukunftsentwicklungen in bestimmten Sektoren zu erwarten sind. In Kapitel 6 werden notwendige Maßnahmen aus jeweils chinesischer und deutscher Sicht diskutiert und in Kapitel 7 ein Fazit daraus gezogen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung12.Chinas wirtschaftliche Entwicklung vor dem Eintritt in die WTO12.1 Chinas Historie vor der Reform- und Öffnungspolitik 1978112.1.1 Das Zeitalter der Dynastien1 2.1.2 Der Einzug der Europäer2 2.1.3Die Republik China3 2.1.4 Die Ära von Mao Zedong3 2.2 Der Prozess des Umdenkens Reform- und Öffnungspolitik ab 19784 2.2.1Die Wirtschaftslage Chinas 19784 2.2.2Das trial-and-error -Verfahren der Wirtschaftstransformation5 2.2.2.1 Die vier Sonderwirtschaftzonen6 2.2.2.2 Erste Erfolge der Liberalisierung7 2.2.3 Weitere Phasen der Reform- und Öffnungspolitik8 3.Der Beitritt in die WTO9 3.1 Das GATT und die Entwicklungen bis zur Gründung der WTO10 3.1.1 Chinas Bemühungen zum Beitritt in das GATT11 3.2 Grundlagen der Welthandelsorganisation (WTO)12 3.2.1 Die wichtigsten Hauptabkommen der WTO12 3.2.2Struktur, Prinzipien und Funktionen der WTO13 3.2.3 Chinas Bemühungen zum Beitritt in die WTO14 4.Auswirkungen des WTO Beitritts auf China15 4.1Direkte Auswirkungen164.1.1 Die Landwirtschaft und für China bedeutende Industrien16 4.1.1.1 Entwicklungen in der Landwirtschaft vor dem Beitritt in die WTO16 4.1.1.2 WTO Vereinbarungen für den B. 60 pp. Deutsch.
-
Möglichkeiten der (teil-)automatisierten Publizierung von Printmedien aus XML-Daten
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600242 ISBN 13: 9783836600248
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Technische Kommunikation, Note: 1,3, Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft (Fakultät für Sozialwissenschaften, Studiengang Technische Redaktion), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Immer mehr Unternehmen entscheiden sich heutzutage für den Einsatz von Content Management Systemen in Verbindung mit strukturierten XML-Daten für das Erstellen, Verwalten und Publizieren interner und externer Informationen. Der Grund hierfür sind steigende Ansprüche an Qualität, Aktualität und Flexibilität technischer Information auf der Anwenderseite und gestiegener Kosten- und Zeitdruck durch globalen Wettbewerb und kürzere Produktlebenszyklen auf der Herstellerseite. Gegen diesen scheinbaren Widerspruch versprechen Content-Management-Systeme (CMS) in Verbindung mit den Methoden Single Source Publishing und Cross Media Publishing Abhilfe. Mit CMS können Inhalte medienneutral erstellt, abgelegt, verwaltet, wieder verwendet und in verschiedenen Ausgabemedien wie Papier, Internet, CD-Rom oder WAP publiziert werden. Problemstellung:Der Dienstleister Cross Media Documentation GmbH (im Folgenden CMD genannt) unterstützt die Firma Krohne Messtechnik GmbH & Co. KG. bei der Implementierung und Anwendung des XML-basierten CMS Noxum Publishing Studio 4. Im CMS werden Handbücher, technische Datenblätter und Kurzanleitungen (QuickStart Manuals genannt) erstellt, die anschließend in einem (teil-)automatisiertem Satzprozess als druckfertige PDF-Dateien ausgegeben werden sollen. Da die Handbücher und technischen Datenblätter im CMS als medienneutrale XML-Daten vorliegen, muss ein Weg gefunden werden, diese XML-Daten in ein Printlayout zu überführen. Dabei soll das Corporate Design der Firma KROHNE umgesetzt werden, auch wenn automatisierten Satzprozessen der Ruf anhängt, typografisch und layouttechnisch eher mittelmäßige Ergebnisse zu liefern. Unter den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten existieren sowohl teil- als auch vollautomatisierte Lösungsansätze, von denen einige über proprietäre und andere über standardkonforme Technologien realisiert werden.Für CMD wird im Zuge dieser Diplomarbeit ein geeigneter Lösungsweg ermittelt, um die XML-Daten aus dem CMS (teil-)automatisiert in ein druckfertiges, Corporate Design-konformes PDF umzuwandeln. Hierzu werden zunächst verschiedene Lösungsansätze in Hinblick auf ihre Tauglichkeit untersucht. In einer Vorauswahl werden daraufhin diejenigen Ansätze, die für die Problemstellung dieser Diplomarbeit prinzipiell geeignet scheinen, einer genaueren Betrachtung unterzogen und anschließend tabellarisch miteinander verglichen. Dabei wird auf die Rahmenbedingungen bezüglich des CMS und des Corporate Design eingegangen. Die Realisierung und Implementierung der in dieser Arbeit ermittelten Lösung erfolgt durch CMD und die Noxum GmbH, wobei Noxum für die programmiertechnischen Aspekte zuständig ist. Um nachfolgend zu klären, wie gut sich die strengen Vorgaben des Corporate Designs im (teil-)automatisierten Satzprozess tatsächlich umsetzen lassen, wird eine Handbuch-Titelseite im CMS erstellt und anschließend als Print-PDF publiziert. Anhand dieser Titelseite werden auszugsweise Details der Realisierung vorgestellt. In der darauf folgenden Bewertung wird die Lösung hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse und ihrer Vor- und Nachteile beurteilt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung12.Grundlagen32.1Publishing3 2.1.1Traditionelles Publishing42.1.2Modernes Publishing52.1.3Single Source Publishing52.1.4Cross Media Publishing62.2XML72.2.1Inhalt72.2.2Struktur92.2.3Gestalt92.3Content Management102.3.1Content102.3.2Content Management112.3.3Content Management Systeme112.4Corporate D. 108 pp. Deutsch.
-
Die Clean Surplus Bedingung in der internationalen Rechnungslegung
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600641 ISBN 13: 9783836600644
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Dass Unternehmenswerte anstelle von Zahlungsströmen auf Basis von Rechnungswesendaten berechnet werden können, wurde spätestens durch die Arbeiten von Preinreich und Lücke Mitte des vorigen Jahrhunderts bekannt. Durch die beiden Autoren wurde formal nachgewiesen, dass zur Berechnung des Kapitalwertes einer Investition statt der Zahlungsströme auch die Periodenerfolge der Rechnungslegung verwendet werden können. Für die Anwendbarkeit dieser auf so genannten Residualgewinnen basierenden Bewertung muss die Ermittlung der Periodenerfolge aber einer unentbehrlichen Voraussetzung folgen, die als Clean Surplus Bedingung bezeichnet wird. Die Clean Surplus Bedingung besagt, dass sämtliche Änderungen im buchmäßigen Eigenkapital, die nicht aus direkten Transaktionen zwischen Eignern und Unternehmen resultieren, in der Erfolgsrechnung erfasst werden müssen . Wird die Clean Surplus Bedingung erfüllt, entspricht der Unternehmenswert theoretisch der Summe des Eigenkapitals und des Barwerts der Residualgewinne. In der Praxis gibt es jedoch kaum ein Rechnungslegungssystem, das der Clean Surplus Bedingung durchgängig folgt. Vor diesem Hintergrund und angesichts der zunehmenden Anzahl von Clean Surplus Verstößen in der internationalen Rechnungslegungspraxis erscheint es verwunderlich, dass die Clean Surplus Bedingung in der aktuellen Diskussion um das Residualgewinnmodell (RGM) bisher nur eine untergeordnete Rolle spielt. Stattdessen wird die Clean Surplus Bedingung vorwiegend im bilanztheoretischen Kontext diskutiert. Mit der Implementierung der International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) in Deutschland vollzog sich ein grundlegender Wandel der Rechnungslegung von einem durch das Vorsichts- und Imparitätsprinzip geprägten zu einem stärker an beizulegenden Zeitwerten ausgerichteten System. Damit wird dem Ziel des International Accounting Standards Boards (IASB) Rechnung getragen, ein kapitalmarktorientiertes Rechnungslegungssystem zu entwickeln, das den Kapitalmarktteilnehmern und anderen Nutzern dieser Informationen bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Als entscheidungsnützlich werden die Informationen bezeichnet, mit deren Hilfe die Fähigkeit eines Unternehmens, Cashflows zu erzeugen, beurteilt werden kann. Dadurch soll den Unternehmenseignern, Gläubigern und anderen Interessengruppen die Möglichkeit gegeben werden, die Beträge, den Zeitpunkt und das Risiko zukünftiger Zahlungsein- und -ausgänge abschätzen und damit die eigene Position gegenüber dem Unternehmen bewerten zu können. In manchen Fällen schlagen sich jedoch nach IAS/IFRS nicht alle Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nieder. Einige Sachverhalte, die zumeist aus Wertveränderungen bestimmter Vermögenswerte resultieren, werden direkt erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet. Diese Vorgehensweise verstößt zwar gegen die Clean Surplus Bedingung, soll aber einen besseren Einblick in die Vermögenslage des Unternehmens ermöglichen, da stille Reserven und Lasten sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig wird ein nachhaltiger, weniger volatiler und damit besser prognostizierbarer Periodenerfolg ausgewiesen. Als Konsequenz dieser Gegebenheiten wird eine genauere Einschätzung der künftigen Zahlungsstrukturen vermutet.Die in der internationalen Rechnungslegung begangenen Clean Surplus Verstöße wären damit teilweise mit der Verbesserung der Prognose künftiger Cashflowströme gerechtfertigt, wodurch die Anwendung der in der Unternehmensbewertung stark verbreiteten Discounted Cashflow (DCF) Methode nicht unwesentlich erleichtert werde. 104 pp. Deutsch.
-
Institutionelle Faktoren und Anreizstrukturen im Schulwesen
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600625 ISBN 13: 9783836600620
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 1,3, Universität zu Köln (Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Bildungswesen steht in nahezu allen Ländern unter der Aufsicht des Staates und wird in hohem Maße mittels öffentlicher Gelder finanziert. Traditionell dominiert in Bildungssystemen eine zentrale Input-Steuerung der Schulen. Dazu gehört u. a. die staatliche Zuteilung von Finanz- und Personalressourcen, die Vorgabe von Richtlinien und Lehrplänen sowie umfassende rechtliche und administrative Regelungen. Insbesondere in Deutschland wurde der staatliche Bildungsauftrag (Artikel 7 des Grundgesetzes) in ein bis heute stark administrativ-zentralistisch ausgeprägtes Steuerungssystem umgesetzt, in dem die einzelnen öffentlichen Schulen weitgehend unselbständig sind und verwaltungstechnisch als nachgelagerte Behörden [fungieren], die ihre Dienstleistungen nach vorgegebenen Normen und Dienstanweisungen zu erbringen haben. Durch internationale Schulleistungsstudien wie TIMSS und PISA wird jedoch zunehmend deutlich, dass sich die Qualität der schulischen Bildung allein mit einer staatlich administrierten und an Ressourceninputs orientierten Lenkung nicht sichern lässt. Denn zum einen erreichen Länder trotz vergleichbarem Ressourceneinsatz (gemessen am prozentualen Anteil der Bildungsausgaben am nationalen BIP) höchst unterschiedliche Resultate bei den gemessenen Bildungsergebnissen. Zum anderen lässt sich empirisch nachweisen, dass dezentrale Ressourcenverantwortung, Konkurrenz unter Schulen und damit verbundene output-orientierte Steuerungsansätze positive Effekte auf die Bildungsleistungen von Schülern ausüben. Auch im deutschen Bildungssystem werden mit dem administrativen Steuerungsansatz allem Anschein nach wesentliche Ziele nicht (mehr) erreicht. Das gilt nicht nur mit Blick auf die Bildungsergebnisse wie bspw. die im PISA-Vergleich (erneut) unterdurchschnittlichen Testleistungen deutscher Schüler. Ebenfalls lassen sich in Bezug auf die Effizienz und Effektivität des Ressourceneinsatzes im Bildungsprozess hier zu Lande Defizite ausmachen. Schließlich wird, wie PISA gezeigt hat, ein weiteres Ziel und gleichzeitig eine wesentliche Legitimationsgrundlage einer staatlich-administrativen Bildungsproduktion die aus Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitete Gewährleistung gleicher Bildungschancen im derzeitigen deutschen Schulsystem nicht erreicht.Diese Befunde zeigen, dass dem Bildungsprozess, welcher sich zwischen staatlichen Mittelzuweisungen (Inputs) einerseits und Bildungsergebnissen (Outputs) andererseits vollzieht, nicht nur aus pädagogischer Sicht Beachtung geschenkt werden sollte. Mit Blick auf den ineffizienten Einsatz bzw. die mögliche Fehllenkung von begrenzten Ressourcen (d. h. öffentlichen Steuergeldern) kommt dem Prozess der Bildungsproduktion nämlich auch aus ökonomischer Sicht eine erhebliche Bedeutung zu. Darüber hinaus scheint eine ökonomische Analyse des Bildungssystem aufgrund des beträchtlichen Umfangs der für den Bildungsbereich aufgewendeten Mittel und der Bedeutung von Humankapital für das (Lebens-)Einkommen und die Beschäftigungswahrscheinlichkeit des Einzelnen sowie für das Wirtschaftswachstum und das Beschäftigungsniveau der gesamten Volkswirtschaft nicht nur legitim sondern geradezu unerlässlich.Vor dem Hintergrund einer zweifelhaften Qualität schulischer Bildung einerseits sowie knapper öffentlicher Kassen andererseits liegt es nahe, auch für das deutsche Bildungssystem eine verstärkte Nutzung dezentraler und marktkonformer Steuerungselemente zu fordern. Dennoch existieren nach wie vor große Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von Marktinstrumenten im Bildungsbereich. Häufig wird angeführt, das Gut Bildung sei zu wichtig, um es den Marktkräften zu überlassen und Bildung sei keine Ware. Die beob. 112 pp. Deutsch.
-
Kommunale Jugendhilfeplanung und Neue Steuerung - Widersprüche, Chancen, Perspektiven
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600137 ISBN 13: 9783836600132
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,0, Leuphana Universität Lüneburg (Sozialwesen, Weiterbildender Studiengang Sozialmanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Das Thema Verwaltungsmodernisierung oder Neue Steuerung beherrscht seit einiger Zeit die Diskussion um die Gestaltung der kommunalen Aufgaben und die Bedeutung für eine sachgerechte Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Dies wird von Teilen der Jugendhilfe kritisch gesehen, etwa wenn Jugendhilfe auch unter dem Gesichtspunkt von Effektivität und Effizienz betrachtet werden soll. Die Fachdiskussion neigt zu einer polarisierenden Betrachtung: Pädagogische Ansprüche der Jugendhilfe und betriebswirtschaftliche Strategien der Neuen Steuerung stehen sich gegenüber.Die vorliegende Arbeit will dazu beitragen, zwischen Jugendhilfe einerseits und Neuer Steuerung bzw. Verwaltungsreform andererseits einen Bogen zu schlagen.Zugleich ist mit dieser Abschlussarbeit im Studiengang Sozialmanagement beabsichtigt, zwei Studienbereiche - Jugendhilfeplanung und Controlling/Steuerung - miteinander zu verbinden. Dabei soll der Bezug dieser beiden Themenbereiche zur Praxis kommunaler Jugendhilfe hergestellt werden. So werden Instrumente für die Planung und Steuerung der Jugendhilfe vorgestellt und ihre Anwendungsmöglichkeiten und Begrenzungen diskutiert.Dazu sollen die vom Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - bzw. (syn.) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - vorgegebenen Grundlagen, Verfahrensweisen und Instrumente zur Steuerung der Jugendhilfe dargestellt werden, insbesondere die Jugendhilfeplanung. Zugleich werden die Konzepte und Methoden der Neuen Steuerung unter dem Aspekt betrachtet, inwiefern sie dem Jugendamt Möglichkeiten eröffnen, durch ergebnisorientierte Verfahrensweisen planerische Prozesse effektiver zu organisieren und Zielvorgaben stärker in die Praxis umzusetzen.Gang der Untersuchung:Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird daher die Jugendhilfeplanung als strategisches Fachplanungsinstrument mit seinen Elementen und Prozessen eingehend beschrieben. Im zweiten Kapitel wird demgegenüber das Managementmodell der Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) zur Neuen Steuerung erläutert, wobei jeweils der Bezug zum Bereich der Jugendhilfe hergestellt wird.Daran schließt sich eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Modell der KGSt an, gefolgt von den Vorgaben und notwendigen Ergänzungen des SGB VIII. Ein weiteres Kapitel stellt ein integratives Steuerungs- und Managementsystem Balanced Scorecard vor, das durch seinen multidimensionalen Ansatz die Möglichkeit zur Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Neuem Steuerungsmodell eröffnet. Dieses Instrument wird neuerdings in ersten Projekten der sozialen Arbeit eingeführt.Ferner werden zwei Steuerungskonzepte aufgegriffen, die zur Zeit von zwei kommunalen Jugendhilfeträgern erprobt werden: Ein Controlling-Konzept sowie eine Balanced Scorecard aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung (siehe Anhang C und E). Hierdurch, wie auch durch weitere Materialien und Graphiken sollen die theoretischen Ausführungen veranschaulicht und der Praxisbezug zu aktuellen Veränderungsprojekten hergestellt werden.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisEinleitu ng41.Jugendhilfeplanung ein Instrument der fachlichen Steuerung61.1Grundlagen der Jugendhilfeplanung61.1.1Definitionen und Ziele61.1.2Jugendhilfeplanung als Teil kommunaler Entwicklungsplanung81.1.3Rechtliche Vorgaben des SGB VIII91.1.3.1Planungsverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers101.1.3.2Planungsaufgaben111.1.3.3Zielvorgaben131.1.3.4Beteiligun g freier Träger an der Jugendhilfeplanung141.1.3.5Planungskoordination151.1.3.6Der Jugendhilfeausschuss im Rahmen der Pla. 212 pp. Deutsch.
-
Stiftungen - Steuersparmodell für die Praxis?
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 383660048X ISBN 13: 9783836600484
Seller: Rheinberg-Buch Andreas Meier eK, Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 2,1, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule (Betriebswirtschaftslehre, Betriebliches Steuerwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:In Deutschland existierten im Jahre 2005 ca. 2,1 Mio. Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 50.000 Euro. Knapp 94,5 Prozent davon werden als Familienunternehmen geführt, von denen etwa 70.900 u. a. aus Gründen des Alters oder eines Tätigkeitswechsels des Unternehmers als übergabereif gelten. Neben dem Verkauf oder der Vererbung an Familienmitglieder stehen dem Unternehmer weitere Nachfolgemodelle zur Verfügung. Für die tatsächliche Wahl kann keines dieser Modelle als Patentrezept für zivil- und steuerrechtliche Problemstellungen verstanden werden, da individuelle Faktoren berücksichtigt werden müssen.Als potenzielle Nachfolgelösung entwickelt sich vermehrt die Rechts- und Unternehmensform der Stiftung. Mit einer Anzahl von 880 neugegründeten rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts im Jahre 2005 wird der stetige Aufwärtstrend der Stiftungserrichtung fortgesetzt. Mittlerweile existieren im gesamten Bundesgebiet 13.490 Stiftungen. Dennoch müssen diese Zahlen im Vergleich zur o. g. Anzahl von jährlichen Unternehmensübertragungen relativiert werden.Für die Untersuchung sind neben der dargestellten Tendenz, das steigende Interesse an Stiftungen sowie die charakteristischen Kennzeichen dieser Rechtsform ausschlag-gebend. So erlaubt die Stiftung ein hohes Maß an Gestaltungsflexibilität, sodass neben ideellen Beweggründen auch zivil- und steuerrechtliche Überlegungen elementar sind.Die private und unternehmerische Nachfolgeplanung impliziert einen Gesellschafts- und Privatvermögenstransfer, der ertrags- sowie substanzsteuerlich optimal gestaltet werden sollte. Inwiefern eine Stiftung im Vergleich zu anderen Nachfolgemodellen geeignet ist, Steuern zu sparen und praktische Relevanz zu erreichen, soll in vorliegender Arbeit eruiert werden.Gang der Untersuchung:Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der Komplexität und Variabilität der Rechtsform der Stiftung mit einer Vertiefung steuerrechtlicher Besonderheiten. Die allgemeine Untersuchung des Stiftungswesens wird durch eine Fokussierung steuer-optimaler Stiftungskonstruktionen aufgegriffen. Dabei wird ein Bezug des Stifters zu seiner Familie unterstellt, um den Vergleich der erbrechtlichen Vermögensübertragung zu gewährleisten.Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Themenbereiche.Der Einleitung nachfolgend wird mit einer Vorstellung verschiedenster Stiftungsformen in Kapitel 2 begonnen. Dabei werden einführende steuerliche Gegebenheiten einzelner Stiftungsarten mitaufgegriffen. Anschließend erfolgt eine Darstellung zivilrechtlicher Grundlagen des Stiftungsrechts sowie ein allgemeiner Ausblick auf weitere Nachfolgeoptionen.Im 3. Kapitel wird eine Untersuchung der Besteuerung von Stiftungen vorgenommen. Hier wird die erbschaftsteuerliche Gesetzgebung von Stiftungen mit wesentlichem Familieninteresse akzentuiert.In Kapitel 4 wird der Familienbezug durch die Untersuchung von Familienstiftungen fortgesetzt. Weiterhin werden Kombinationsmodelle, die der Minimierung der Besteuerung dienen und praktische Anwendung finden, ermittelt. Die Betrachtung der Motive sowie ein Vergleich zur gesetzlichen Erbfolge schließen das Kapitel ab.Mit dem Fazit in Kapitel 5 wird diese Arbeit beendet.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIAbkürzungsverzeichnisIIIAbbild ungsverzeichnisV1.Einleitung11.1Problemstellung11.2Zielsetzu ng und Konzept der Arbeit22.Stiftungen im zivil- und steuerrechtlichen Kontext32.1Begriffsdefinition: Rechtsgrundsatz der Stiftung32.2Er. 84 pp. Deutsch.
-
Probleme des Wissenstransfers bei Personalfluktuation
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600420 ISBN 13: 9783836600422
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 2,3, Freie Universität Berlin (Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Die vorliegende Diplomarbeit gibt theoretische und empirische Einblicke in die Problematik der Organisation des Wissenstransfers am Spezialfall der Personalfluktuation. Dabei wird hier von einem Koordinationsproblem und einem Motivationsproblem der Organisationsmitglieder ausgegangen. In der Arbeit widmen wir uns hauptsächlich dem Motivationsproblem, da es im Gegensatz zum Koordinationsproblem ein weniger unternehmensspezifisches und somit allgemeingültigeres Problem darstellt.Im Kern dieser Arbeit fokussieren wir auf eine theoriebasierte Analyse des Wissenstransfers und die Identifikation möglicher Einflussfaktoren auf die Motivation zum Wissenstransfer. Hierfür haben wir ein Modell entworfen, welches die für uns als wichtig erachteten individuellen und kollektiven Einflüsse auf die Motivation zum Wissenstransfer enthält. Diese Einflussfaktoren werden zuerst theoretisch erläutert und bilden die Grundlage für die sich anschließende qualitativ-empirische Betrachtung. Hierzu wurden Wissenstransfer-Manager sowie Personen, die auf Grund von Fluktuation an Wissenstransferprozessen beteiligt waren, befragt. Ziel dieser Befragung war es die theoretisch abgeleiteten Einflussfaktoren auf die Wissenstransfermotivation, mit Hilfe empirischer Untersuchungen zu identifizieren. Gang der Untersuchung:Ausgehend von der Zielsetzung unserer Arbeit werden in Kapitel zwei die theoretischen Grundlagen zum Wissenstransfer erläutert. Wir stellen verschiedene Typologisierungen des Wissensbegriffs vor und ordnen den Wissenstransfer in das Themengebiet des Wissensmanagements ein.Kapitel drei befasst sich mit der Personalfluktuation. Hier werden die verschiedenen Fluktuationsarten erläutert und die Fluktuationsgründe nach den Kriterien ihrer Vorhersehbarkeit und Beeinflussbarkeit beurteilt und entsprechend eingeordnet. Das Motivationsproblem des Wissenstransfers wird ausführlich im Kapitel vier betrachtet. Dazu dient uns ein Analyseschema, das mögliche Einflüsse auf die Wissenstransfermotivation widerspiegelt. Weiterhin wird in diesem Kapitel herausgearbeitet, mit welchen Motiven und Anreizen allgemeine Motivation, sowie Motivation zum Wissenstransfer hervorgerufen werden kann. Des Weiteren werden die Motivationsarten extrinsische und intrinsische Motivation erläutert.Im Kapitel fünf rücken die erwähnten Einflussfaktoren ins Zentrum der Analyse. Dabei gehen wir auf Koordinationseinflüsse sowie individuelle und kollektive Einflussfaktoren ein. Der Schwerpunkt in diesem Kapitel liegt auf den kollektiven Einflüssen. Bei den individuellen Einflüssen werden eher Motivationsbarrieren betrachtet, während wir bei den kollektiven Einflussfaktoren unterschiedliche Wirkungen von Unternehmenskultur und Vertrauensbeziehungen anführen. Das sechste Kapitel stellt den methodischen Ansatz der empirischen Untersuchung vor. Unsere Analyse des Wissenstransfers und der Transfermotivation am Beispiel der Personalfluktuation orientiert sich eher an konkreten Erfahrungen und subjektiven Eindrücken. Um die Beweggründe der Organisationsteilnehmer für bestimmte Handlungen zu erschließen und um eine Offenheit für neue Aspekte zu gewährleisten, legten wir uns deshalb auf die Durchführung einer qualitativen empirischen Untersuchung fest. Denn die qualitative Forschung erlaubt es, Erfahrungswirklichkeiten zu verbalisieren, um diese dann zu interpretieren.Kapitel sieben beschäftigt sich zum Abschluss unserer Arbeit mit der empirischen Betrachtung und der Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Dabei werden wir zuerst Design und Methoden der Datenerhebung vorstellen sowie unsere Vorgehensweise bei der Durchführung der Datenerhebung erläutern. Als ko. 236 pp. Deutsch.
-
Bedingungsvariablen schöpferischen Denkens
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600285 ISBN 13: 9783836600286
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Psychologie - Sozialpsychologie, Note: 1,0, Universität Bremen (11, Human- und Gesundheitswissenschaften, Psychologie und Kognition), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Kreativität zählt zu den wundersamsten Fähigkeiten des Menschen. Alle bedeutenden wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen können als Produkte kreativen Denkens betrachtet werden. Aufgrund der Bedeutung kreativen Denkens für die Lösung von Problemen wurden in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Untersuchungen der Voraussetzungen der kreativen Produktivität durchgeführt. Die Forschung wurde dabei von der Annahme geleitet, dass bestimmte soziale Einflüsse zur Entwicklung von Persönlichkeitseigenschaften beitragen, die das Auftreten spezifischer kognitiver Prozesse begünstigen, die sich in Form kreativen Denkens manifestieren.Vor diesem Hintergrund wird auf Grundlage der Ergebnisse der Kreativitätsforschung im Rahmen dieser Arbeit versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Faktoren an der Entstehung kreativer Leistungen beteiligt sind. Zu diesem Zweck werden die Bedeutung und Funktion spezifischer kognitiver Prozesse, Persönlichkeitsvariablen und sozialer Einflüsse für die Entstehung kreativer Ideen und Handlungen einer genauen Betrachtung unterzogen.Gang der Untersuchung:Beginnend mit einer Definition des Konstrukts Kreativität (Punkt 1.) wird ein Überblick über die Geschichte der Kreativitätsforschung gegeben (Punkt 2.) um im Text angeführte Theorien in ihrer Entwicklungslogik historisch einordnen zu können.Punkt 3. beinhaltet die Beschreibung der wichtigsten Methoden und Messverfahren für die Datensammlung im Feld der Kreativitätsforschung.Die Bedeutung externer Beurteilung einer neuen Idee auf ihre Kreativität und die damit verbundene Problematik, für diesen Zweck geeignete Kriterien zu finden, stehen im Zentrum von Punkt 4. Hier soll aufgezeigt werden, dass Kreativität keine immanente Eigenschaft eines Produktes ist, sondern als Prädikat zu betrachten ist, das diesem von mehr oder weniger kompetenten Personen verliehen wird.Verfahren zur Beurteilung der Kreativität auf Grundlage der unter Punkt 4. beschriebenen Kriterien werden in Punkt 5. angeführt.In der nachfolgenden Diskussion (Punkt 6.) werden die unter Punkt 5. vorgestellten Messverfahren einer kritischen Wertung unterzogen.Im nächsten Abschnitt (Punkte 7. bis 7.6) werden Charakteristiken des kreativen Prozesses und des Problemlösungsprozesses vorgestellt und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht. Ziel ist es hier, eine mögliche Konvergenz oder Divergenz beider intellektueller Prozesse aufzuzeigen, die im Hinblick auf die Identifizierung kreativitätsspezifischer kognitiver Prozesse von Bedeutung ist.Im folgenden Abschnitt (Punkt 8. bis 8.8) wird ein Überblick über Persönlichkeitsfaktoren gegeben, von denen angenommen wird, dass sie in Zusammenhang mit kreativen Leistungen stehen. Diese umfassen Variablen, die die kognitive Leistungsfähigkeit betreffen (Intelligenz) und solche, die an der Steuerung kognitiver Inhalte beteiligt sind (Heurismen, kognitiver Stil). Weitere Variablen beziehen sich auf energetisierende (Motivation) und affektive Aspekte (Emotion) kreativer Prozesse. Außerdem soll gezeigt werden, dass sich kreative Menschen auch durch Wissen, spezifische Interessen und Einstellungen auszeichnen.Im letzten Abschnitt (Punkt 9. bis 9.5) wird die Bedeutung und Funktion sozialer Einflüsse für die kreative Leistung analysiert. Hierzu wird auf den Ebenen der Familie, Schule, Organisation und Gesellschaft spezifiziert, welche Arten von Umwelteinflüssen welche Aspekte des kreativen Verhaltens fördern oder hemmen können.Abschließend folgt eine Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse auf Grundlage der Fragestellung dieser Arbeit.Inhaltsv. 156 pp. Deutsch.
-
Wetterderivate als Instrument der Risikosteuerung
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 383660034X ISBN 13: 9783836600347
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Geowissenschaften / Geographie - Meteorologie, Aeronomie, Klimatologie, Note: 1,8, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Bereits in der griechischen und römischen Mythologie wurde dem Wetter besondere Bedeutung geschenkt. Sowohl der römische Gott Jupiter als auch der griechische Gott Zeus galten als Wettergötter . Sie sandten Regen und Stürme, schickten Blitze und Donner. Opfergaben waren damals die beste Lösung, um die Götter friedlich zu stimmen. Was sich die Griechen und Römer von Opfergaben erhofften, können heutzutage sog. Wetterderivate ermöglichen: die Vermeidung ökonomischer Nachteile, welche durch unerwünschte Wetterentwicklungen entstehen.Wetterderivate wurden entwickelt, um Umsatz- und Gewinnrisiken, welche sich durch die Unsicherheit über das Wetter ergeben, effizient abzusichern. Die Kernidee von Wetterderivaten und das Neue an diesem Instrument ist das Hedging von Mengen- bzw. Volumenrisiken. Vereinfacht dargestellt ergibt sich der Umsatz eines Unternehmens aus der Menge der abgesetzten Produkte, multipliziert mit den entsprechenden Preisen. Während die Absicherung von Preisrisiken bereits seit Jahrzehnten zum Standard eines jeden Risikomanagements gehört, sind derivative Intsrumente zum Hedging der Mengenrisiken noch nicht allgegenwärtig in den Blickpunkt gerückt.Aufgrund der Liberalisierung der Energiemärkte ist das Risikobewusstsein der hiesigen Marktteilnehmer gestiegen. Um weiterhin Wachstumskapital verfügbar zu machen, sehen sich die Energieversorgungsunternehmen (EVUs) zunehmend gezwungen, ihren Eigentümern verlässliche Prognosen ihrer Erträge zu liefern. Da deregulierte Märkte ausgeprägte Preisschwankungen, unkalkulierbare Absatzverluste und viele weitere Risiken mit sich bringen, steigt das Interesse an neuen Alternativen der Risikosteuerung.Das Mengenrisiko von EVUs wird zusätzlich verschärft durch die Wetterabhängigkeit der Energienachfrage. Diverse Wetterfacetten, wie z. B. Temperatur, Niederschlag oder Bedeckungsgrad haben direkten Einfluss auf den Stromverbrauch von privaten Haushalten und Unternehmen. Dieses Risiko wäre zu vernachlässigen, wenn verlässliche Wetterprognosen existent wären. Derzeit kann das Wetter mit hoher Genauigkeit lediglich für einen Zeithorizont von etwa fünf Tagen vorhergesagt werden. Die Energieversorgung hingegen wird zum überwiegenden Teil bereits Monate vor der physischen Lieferung abgewickelt.In der früheren, staatlich regulierten Marktstruktur besaßen EVUs die Möglichkeit, auf für sie unvorteilhafte Wetterentwicklungen mit Preiserhöhungen zu Lasten der Konsumenten zu reagieren. Das heutige, auf Wettbewerb ausgerichtete Marktumfeld lässt derartige Maßnahmen zur Kompensation von witterungsbedingten Umsatzausfällen nicht länger zu.Aus diesem Grund entwickelte sich im Energieversorgungssektor Mitte der 90er Jahre eine dem Begriff Wetterderivat zuzuordnende Klasse von Finanzinstrumenten, welche das Hedging von Wetterrisiken auf marktwirtschaftlicher Basis ermöglicht.Gang der Untersuchung:Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen komprimierten Überblick über den Einsatz von Wetterderivaten als Risikosteuerungsinstrumente für EVUs zu geben. Diesbezüglich sollen Wetterrisiken aus deren Blickwinkel dargestellt sowie Möglichkeiten aufgezeigt werden, diese in ihr betriebliches Risikomanagement integrieren zu können. Ebenfalls werden die vorherrschenden Marktkonstellationen sowie die bislang hauptsächlich angewandten Produkte vorgestellt. In diesem Zusammenhang soll gezeigt werden, dass sich der Markt für Wetterderivate noch in einem Entwicklungsprozess befindet und erhebliche Schwachstellen aufweist. Diese werden kritisch analysiert.Fall. 116 pp. Deutsch.
-
Rohstoffe als strategische Assetklasse
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600080 ISBN 13: 9783836600088
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Hochschule Aschaffenburg (Wirtschaft und Recht, Studiengang Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Rohstoffe (engl. Commodities ) sind eines der Trendthemen im Anlagebereich der letzten Jahre. Nach dem Untergang des neuen Marktes und der weltweiten Unsicherheit an den Börsen entwickelten sie sich mehr oder weniger unauffällig zu einer der renditeträchtigsten Assetklassen der vergangenen Jahre. Bis dahin fanden Rohstoffe weder bei privaten Anlegern noch bei institutionellen Investoren Beachtung.Dies änderte sich vor allem in den letzten drei Jahren, als Banken, Investmenthäuser und Rohstoffexperten verstärkt begannen, aktiv für ihre rohstoffbasierten Produkte zu werben. Diese entwickelten sich hervorragend, da die Rohstoffpreise ständig neue Allzeithochs erreichten. Superlative wie Megazyklus oder 15 Jahre andauernde Mega-Hausse waren und sind in vielen Broschüren und Tageszeitungen zu lesen. Jedoch mehren sich mittlerweile auch die Stimmen derer, die den Rohstoffmarkt als ein ähnlich überhitztes Gebilde betrachten, wie es der neue Markt war. Die Korrekturen in vielen Bereichen der Rohstoffmärkte werden als Indiz dafür gesehen.Ungeachtet der aktuellen, sich zum Teil schnell ändernden Situation, stellt sich für den Kapitalanleger die Frage, welche Argumente für Rohstoffe als alternative Anlageform sprechen und ob sie sich als eigenständige Assetklasse in der strategischen Asset Allocation bzw. in einem strategisch ausgerichteten Portfolio eignen.Aus Entwicklungen der Vergangenheit, den Studien von Markowitz und Sharpe und den jüngsten Ergebnissen steht fest, dass ein diversifiziertes Portfolio unumgänglich ist. Hierzu bedarf es einer strategischen Ausrichtung, um langfristig erfolgreich zu sein. Doch welche Assetklassen eigenen sich für ein strategisch optimal ausgerichtetes Portfolio Sind dazu nur die klassischen, nach Regionen und eventuell Währungen unterschiedenen Anlageformen wie Aktien, Renten und Immobilien in der Lage, oder bedarf es einer Innovation durch alternative Anlagen oder Rohstoffe Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine optimale Portfolioausrichtung wohl nicht mehr nur ausschließlich mit den klassischen Anlageprodukten vorgenommen werden kann und das zur Ereichung einer akzeptablen Rendite mit dementsprechendem Risiko eine weitere Diversifikation unumgänglich ist.Gang der Untersuchung:Im ersten Kapitel der Arbeit wird die Entwicklung von Rohstoffen und der Rohstoffmärkte beschrieben.In den beiden folgenden Abschnitten wird näher auf die einzelnen Rohstoffe, deren Besonderheiten und Eigenschaften eingegangen, sowie auf die Indizes mit ihren spezifischen Eigenschaften. Das ist Notwendig, da diese und natürlich die Rohstoffe selbst, die Basiswerte der verschiedenen Finanzprodukte darstellen, die letzten Endes die Assets in einem Portfolio sind.Das vierte Kapitel beschäftigt sich im Folgenden explizit mit den verschiedenen, auf Rohstoffen basierenden, Finanzprodukten.Nach der Erläuterung der Funktionsweise der verschiedenen Produkte, zeigt das fünfte Kapitel die Gründe für eine Portfoliobeimischung von Rohstoffen und die damit verbundenen Risiken auf.Darauf folgend wird eine optimierte Asset Allocation unter Verwendung von Commodities in einem strategisch ausgerichteten Portfolio hergeleitet. Hierfür wurde zuerst die strategische von der taktischen Allocation unterschieden. Anschließend wird durch den Vergleich von mehreren Zeitreihen repräsentativer Indizes und die Bildung verschiedener Portfolios gezeigt, dass sich Rohstoffe durchaus zur strategischen Ausrichtung und zur Diversifikation eines Portfolios eignen.Schlussendlich werden die Ergebnisse kurz kommentiert und eine vorsichtige Prognose für die Zukunft erstellt. 132 pp. Deutsch.
-
Analyse und Verbesserungsansätze im Rahmen des Qualitätsmanagements der Fertigung bei Firma Mustermann
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600366 ISBN 13: 9783836600361
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,7, HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst - Fachhochschule Hildesheim, Holzminden, Göttingen (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Ziel dieser Arbeit soll die Offenlegung von Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Qualität bei der Fertigung von PKW-Eingußzylinderlaufbuchsen sein. Diese werden fast ausschließlich in Großserien gefertigt und die Produktion läuft über einen langen Zeitraum. Auf Anmerkung von Herrn Mustermann (Koordinator für Qualität, Mustermann GmbH) beschränkt sich diese Arbeit auf den Fertigungsprozess der konventionellen Produktionsschiene. Eine Beleuchtung des gesamten Fertigungsprozesses, von Auftragsannahme über Planung und Gießvorgang bis hin zur Fertigung, stellt ein zu komplexes und umfangreiches Gebiet für diese Diplomarbeit da.Der Prozess der Großserienfertigung ist das Hauptgeschäft der Firma Mustermann und birgt die besten Möglichkeiten Verbesserungspotenziale auszuschöpfen. Die Bereiche der Schiffsmotorenlaufbuchsen und der Bereich der LKW-Buchsen ist nur ein Nebengeschäft der Firma. Diese Buchsen werden meist nur in kleinen Serien produziert und sind dadurch schwer auf Verbesserungspotenziale zu durchleuchten. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt folgerichtig in der Aufdeckung von Verbesserungspotenzialen in der konventionellen Produktionsschiene. Auf dieser Schiene werden Großserien für die Automobilhersteller produziert. Im Verlauf dieser Arbeit wird durch Analyse des momentanen Fertigungsprozesses auf der konventionellen Produktionsschiene das mögliche Verbesserungspotential dargelegt. Es werden Verbesserungsvorschläge erarbeitet und der Firmenleitung vorgestellt. Gang der Untersuchung:In dem ersten Teil dieser Arbeit wird eine kurze Einleitung zum Thema gegeben. Im Weiteren werden die Zielsetzungen der Arbeit dargestellt. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des Themas von der Begriffsdefinition von Qualität über das angewandte Prozessmodell der Firma Mustermann bis zu den allgemeinen Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Anschließend folgt im dritten Teil die praktische Umsetzung der theoretischen Grundlagen. Nach einer kurzen Vorstellung der Firma Mustermann GmbH wird der Produktionsprozess auf Verbesserungspotenziale analysiert und es werden Verbesserungsvorschläge dargelegt. Im vierten Teil wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung gegeben. Den Abschluss bildet das Fazit der angefertigten Arbeit. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis2Abkürzungsverzeichnis4Abbildungsverzeichnis71.Einleitung8 1.1Zielsetzung81.2Aufbau der Arbeit92.Theoretische Grundlagen102.1Die Definition des Begriffs Qualität102.1.1Die Qualität als zentrale Forderung102.1.2Die Definition des Qualitätsmanagement122.1.3Die Definition eines Qualitätsmanagementsystemes122.1.4Grundprinzip des lernenden Unternehmens132.2Der Geschäftsprozess und das Geschäftsprozessmanagement142.3Die Systemanalyse allgemein sowie die Systemanalyse im Zertifizierungsprozess152.4Die Prozess und Prozessmanagement Definition172.4.1Die Prozessebenen und -elemente einer Organisation182.4.2Die Prozesslandschaft eines Unternehmens212.4.3Die Prozessplanung, deren Prozessgestaltung, -strukturierung und Einführung in die Prozesslandschaft222.5Die Auditierung und deren drei Audittypen232.6Zertifizierung und der Ablauf von Zertifizierungsverfahren252.6.1Die Stärken und Schwächen einer Zertifizierung282.7Die Normen292.7.1Die DIN ISO/TS 16949:2002. Zielsetzung und Ursprung der Norm292.7.2Die DIN EN ISO 900x-Reihe312.7.3Die Über. 80 pp. Deutsch.
-
Erarbeitung einer Marketingkonzeption zur nationalen/internationalen Vermarktung und Etablierung einer neuen Eventlocation in Dresden am Beispiel 'Objekt Demnitz'
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600447 ISBN 13: 9783836600446
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,0, Hochschule Mittweida (FH) (Medien, Media Consulting, Sport- und Eventmanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: The Show must go on , Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren , Begrüßen Sie auf der Bühne , so oder anders soll es künftig in der neuen Eventlocation im Objekt Demnitz aus der Beschallungsanlage ertönen und alle Gäste emotional mitreißen.Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Erarbeitung einer objekt-spezifischen Marketingkonzeption, die als Grundlage für die erfolgreiche Etablierung und Vermarktung der neuen Eventlocation im Objekt Demnitz in Dresden dienen soll.Im Fokus der Bachelorarbeit steht die detaillierte Untersuchung des Eventlocation-Marktes in Dresden, um bestehende Potentiale für das Objekt Demnitz aufzuzeigen und eine erfolgreiche Etablierung zu gewährleisten. Das Hauptaugenmerk der Arbeit richtet sich daher speziell auf die objekt-spezifische Marketingkonzeption und deren spätere Umsetzung.Beginnend werden die relevanten theoretischen Grundbegriffe des Marketings dargestellt, um das Verständnis im Hauptteil dieser Arbeit, der Erstellung des auf die Location und des Objektes Demnitz abgestimmten Marketingkonzeptes, zu unterstützen.Aufschluss über den bestehenden Event-Markt in Dresden wird anhand der Umfeldanalyse der vorhandenen Eventlocations in Dresden, basierend auf einem Fragebogen, gegeben. Auf der Grundlage der Umfeldanalyse wird anschließend das Potential für die Etablierung der neuen Eventlocation geprüft. Eine Zielgruppendefinition ist ebenso Bestandteil dieser Arbeit und analysiert die Zielgruppen, welche für die Nutzung der Location erreicht und angesprochen werden sollen.Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei unter anderem die Fragen; Wer sind meine Wettbewerber Wie sieht meine Zielgruppe aus und Wie vermarkte ich diese Eventlocation, so dass ein Erfolg garantiert ist Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es das Ziel dieser Arbeit ist, darzustellen, wie die neue Eventlocation im Objekt Demnitz unter Berücksichtigung des gegeben Eventlocationmarktes in Dresden vermarktet und langfristig etabliert werden kann. Das Marketingkonzept im Hauptteil dieser Arbeit zeigt die Marketingaktivitäten und Möglichkeiten im Rahmen dieses Konzepts, um das Objekt erfolgreich zu betreiben und langfristig gesehen, einen positiven Bekanntheitsgrad aufzubauen. Vorausblickend kann davon ausgegangen werden, dass der Aufbau einer Marke, die nicht nur am Standort Dresden, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt und anerkannt ist, angestrebt wird.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung12.Theoretische Grundlagen des Marketing / Eventmarketing32.1Was ist Marketing Begriffsdefinition32.2Marketingkonzeption42.2.1Marketingziele52.2.2Marketingstrategie72.2.3Marketin ginstrumente82.2.3.1Produktpolitik92.2.3.2Kommunikationspoli tik102.2.3.3Distributions-/Vertriebspolitik112.2.3.4Preispol itik122.2.4Marketingmix der Marketinginstrumente142.3Marktsegmentierung142.4Zusammenfassung153.Analyse und Perspektiven vorhandener Event- und Tagungslocation in Dresden173.1Externe Umfeldanalyse173.1.1Standort Dresden173.1.2Geographie183.1.3Wirtschaftliche Entwicklung193.1.4Kulturelles Angebot213.1.5Tourismusentwicklung223.1.6Entwicklung Tagungs- und Kongressgeschäft273.1.7Zusammenfassung313.2Wettbewerberanalyse333. 2.1Ziel der Wettbewerberanalyse343.2.2Auswertung der Wettbewerbanalyse353.2.3Zusammenfassung der Wettbewerberanalyse474.Überblick über das Objekt Demnitz484.1Vorstellung484.1.1Geschichte484.1.2G. 116 pp. Deutsch.
-
Die Auswirkungen der HIV/AIDS-Epidemie auf das Wirtschaftswachstum im subsaharischen Afrika
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600315 ISBN 13: 9783836600316
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Sonstiges, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Ziel dieser Arbeit war es, den quantitativen Einfluss der HIV/Aids-Epidemie auf das Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktwachstum der Volkswirtschaften in der besonders stark betroffenen Region des subsaharischen Afrikas zu untersuchen. Hierfür sollte zum einen auf frühere Studien zurückgegriffen und zum anderen eine eigene Analyse durchgeführt werden.Mithilfe des erweiterten Modells von Solow wurden die Hypothesen, dass ein negativer Zusammenhang zwischen der Epidemie und dem Wirtschaftswachstum besteht, empirisch überprüft. Das erweiterte Modell, das nur das Bildungskapital als Teil des Humankapitals beinhaltet, wurde in dieser Analyse um die Komponente Gesundheitskapital erweitert. Über die HIV-Prävalenzrate wurde das Gesundheitskapital operationalisiert. Damit die aus dem Modell erhaltenen Schätzergebnisse robuster sind, wurden weitere, in der Literatur diskutierte Determinanten des Wirtschaftswachstums einbezogen. Nach dem Aufbereiten der gesammelten Daten und unter Berücksichtigung von Autokorrelation und Heteroskedastizität wurden die Parameter des theoretisch fundierten Modells mittels des LSDV-Schätzers bestimmt. Im Vorfeld der empirischen Untersuchung wurde die Literatur, die sich mit den quantitativen Folgen der Epidemie auseinandersetzt, sondiert und kompakt zusammengefasst.Die aufgestellten Hypothesen konnten nicht widerlegt werden. Somit besteht für den Zeitraum von 1997 bis 2003 für die Staaten des südlichen Afrikas ein signifikant negativer Einfluss der Epidemie auf das Wirtschaftswachstum. Dieses Ergebnis ist mit der vorherrschenden Meinung in der Literatur über die Folgen der Epidemie auf das Wachstum konsistent. Aus dieser Untersuchung ergibt sich durch die Epidemie eine durchschnittliche Senkung des PKE-Wachstums von mehr als zwei Prozent - im Vergleich zum Wachstum der letzten Jahre von 0,8 Prozent. Die Ergebnisse der weiteren Variablen im Modell liegen im Einklang mit den Überlegungen in der Literatur und erhöhten durch die Hinzunahme die Signifikanz des Parameters der HIV-Prävalenzrate.Die Ergebnisse dieser Arbeit unterliegen einigen Einschränkungen. Kritisch betrachtet werden muss der kurze Beobachtungszeitraum von nur sieben Jahren. Diese Zeitspanne wurde noch durch den zeitverzögerten Einfluss der Prävalenzrate um zwei Jahre verkürzt, wodurch sich effektiv der Zeitraum auf fünf Jahre erstreckt. Außerdem beruhen die Daten auf Vergangenheitswerten und können daher nicht der uneingeschränkten Schätzungen der zukünftigen Entwicklung der Folgen der Epidemie dienen. Die Analyse wurde nur mit der HIV-Prävalenzrate als Proxy des Gesundheitskapitals durchgeführt, denkbar wären weitere Untersuchungen mit der Anzahl der AIDS-Toten oder den Gesundheitsausgaben bezogen auf das BIP als Operationalisierungsvariable. Aus diesen Einschränkungen können Forderungen an weiterführende Untersuchungen abgeleitet werden.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Abkürzungsverzeichni sIIIAbbildungsverzeichnisIVTabellenverzeichnisVVariablenverz eichnisVI1.Einleitung11.1Hintergrund11.2Problemstellung21.3V orgehensweise32.Die HIV/Aids-Epidemie und die Wirtschaft42.1Der Verlauf der Epidemie im subsaharischen Afrika42.2Demografische Veränderung92.3Die Auswirkungen auf die Haushalte112.4Einflüsse der Epidemie auf den Staat122.5Folgen für die Unternehmen142.6Die ökonomische Lage und Entwicklung des BIP152.7Theoretische Determinanten des BIP-Wachstums182.7.1Arbeit182.7.2Kapital192.7.3Außenhandel212.7.4Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen223.Modellierung des Einflusses v. 112 pp. Deutsch.
-
Optimierung des Ressourcenmanagements durch den Einsatz einer Projektmanagement-Software am Beispiel eines mittelständischen IT-Dienstleistungsunternehmens
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600153 ISBN 13: 9783836600156
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,7, Fachhochschule Mainz (Wirtschaftswissenschaften, Berufsintegrierender Studiengang Betriebswirtschaft BIS (Diplom)), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Auf zunehmenden Konkurrenzdruck und auf immer komplexere und häufig wechselnde Umwelteinflüsse muss ein Unternehmen flexibel reagieren. Dabei spielen die Kontrolle der laufenden Prozesse und eine ständige Optimierung der internen Organisation eine große Rolle, damit das Unternehmen in Zukunft leistungs- und wettbewerbsfähig bleibt.In IT-Dienstleistungsunternehmen sind die wichtigsten Ressourcen die eigenen Mitarbeiter und deren Qualifikation. Aus diesem Grund ist ein gut organisiertes Ressourcenmanagement auf der Basis effizienter Prozesse und einer IT-Infrastruktur mit einem hohen Nutzen notwendig, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und zu erhöhen.Ziel der vorliegenden Arbeit ist das Aufzeigen von Lösungsvarianten für die Optimierung des IT-gestützten Ressourcenmanagements bei einem mittelständischen IT-Dienstleistungsunternehmen. Im Vordergrund steht die Ablösung des Altsystems als Insellösung durch die Integration einer neuen Projektmanagement-Software in die bestehende Systemlandschaft.Gang der Untersuchung:Die Arbeit teilt sich in vier Kernbereiche. Im ersten Teil der Arbeit wird auf die theoretischen Grundlagen des Ressourcenmanagements eingegangen, um das Verständnis für die weiteren Teile der Arbeit zu gewährleisten.Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die Vorstellung eines Modells, das als Bezugsrahmen zur Typisierung sowie zum Vergleich von Projektmanagement-Software dient und alle wichtigen Funktionen von Projektmanagement-Software im Kontext des Projektlebenszyklus abbildet.Der dritte Teil beschäftigt sich mit den Grundlagen des Optimierungsprozesses, des Softwareauswahl- und -einführungsprozesses sowie aller relevanten Aspekte zur Bearbeitung des Praxisprojektes.Das zum Teil durchgeführte Praxisprojekt schließt als vierter Teil diese Arbeit ab. Dabei dienen die vorgenannten Grundlagen als Basis für die Umsetzung der Initialisierung und Vorstudie sowie die teilweise Erarbeitung der Konzeption. Als Ergebnis werden ausgewählte Produkte vorgestellt, die für den Einsatz im IT-Dienstleistungsunternehmen in Frage kommen. Die weitere Vorgehensweise für die Realisierung des Projektes und eine Schlussbetrachtung schließen diese Arbeit ab.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisABKÜRZUNGSVERZEICHNISIIIABBILDUNGSVERZEI CHNISVTABELLENVERZEICHNISVI1.Einleitung12.Grundlagen des Ressourcenmanagements22.1Begriffsbestimmungen22.1.1Ressourcen22 .1.2Ressourcenmanagement22.1.3Projektmanagement-Software32.2 Einordnung des Ressourcenmanagements32.2.1Bedeutung im Dienstleistungsbereich32.2.2Ziele42.2.3Nutzen- und Erfolgspotenziale52.2.4Erfolgs- und Einflussfaktoren62.2.5Positionierung und Prozessablauf92.2.5.1Zentrales Ressourcenmanagement92.2.5.2Dezentrales Ressourcenmanagement113.IT-Unterstützung für das Ressourcenmanagement123.1Bezugsrahmen für Projektmanagement-Softwaresysteme: Das M-Modell123.2Typologie von Projektmanagement-Software143.2.1Ressourcenorientierte Multi-Projektmanagement-Systeme153.2.2Serviceorientierte Multi-Projektmanagement-Systeme154.Optimierung eines IT-gestützten, dienstleistungsorientierten Ressourcenmanagements als Projektaufgabe164.1Informationsbeschaffung und Situationsanalyse164.2Auswahl- und Einführungsprozess für Projektmanagement-Software164.2.1Erfolgsfaktoren164.2.2Vorgehensweise zur Softwareauswahl und -einführung174.3Planung und Durchführung des Einführungs. 120 pp. Deutsch.
-
Die bilanzielle Behandlung von Humankapital und die Möglichkeit seiner Bewertung anhand der Unternehmensorganisation
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600404 ISBN 13: 9783836600408
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,0, Fachhochschule Lausitz (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestellung nach der bilanziellen Behandlung des menschlichen Potentials privatwirtschaftlicher Unternehmen: dem Humankapital.Dabei beginnt die Problemstellung bereits bei der unumgänglichen Auseinandersetzung mit dem Bilanzbegriff. Kann zum Beispiel die Fokussierung auf gesetzlich normierte Rechnungslegungsstandards dem Beobachtenden ein vollständiges Abbild der Unternehmenssituation liefern Welche Aussagekraft in Bezug auf das Kriterium der vollständigen Darstellung der ökonomischen Realität von Unternehmen haben externe Bilanzen, die nach den wichtigsten kodifizierten Rechnungslegungsstandards aufgestellt sind Eine unternehmerische Bilanzierung muss, wenn sie als vollständig gelten soll, umfassend alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte, d.h. auch das Humankapital, eines Unternehmens repräsentieren. Dieser Anspruch wird von keiner externen Unternehmensbilanz, als eine stark reglementierte Ausprägung möglicher bilanzieller Modellvariationen, erfüllt. Regelmäßig bewerten Wirtschaftssubjekte, wie der Aktienmarkt exemplarisch zeigt, Unternehmen anders, als es durch Geschäftsberichte und Jahrsabschlüsse dokumentiert wird. Die Divergenz zwischen beiden Wertaussagen über Unternehmen ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Begründung dessen wird grundsätzlich mit der fehlenden unternehmerischen Bewertungsmöglichkeit der wichtigsten immateriellen Vermögenswerte geführt. Wobei das Humankapital in diesem Zusammenhang als eine Hauptkomponente diskutiert wird.Die zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einsetzende Transformation der industrialisierten Volkswirtschaften zu Informations- und Wissensgesellschaften ist in dieser Beziehung jedoch nicht der Grund, warum es überhaupt notwendig ist, sich über das in Unternehmen existierende Humankapital und die Möglichkeiten seiner Bewertung Gedanken zu machen. Es lässt sich durch Modellannahmen realitätsnaher Prämissen herleiten, dass es wirtschaftstheoretisch nicht begründbar ist, Humankapital nicht zu bilanzieren. Es war schon immer erforderlich, aber erst in Folge der unübersehbaren Entwicklung der zunehmenden divergenten Aussagen zwischen Bilanz- und Marktbewertung in den zurückliegenden 20 Jahren wurde es besonders offenkundig.Für die wissenschaftliche Diskussion ergibt sich bei der Zielsetzung, das intangible asset Humankapital zu erfassen, zu messen und entsprechend zu bewerten eine besondere Herausforderung. Bis heute gibt es kein weitgehend anerkanntes Modell oder Verfahren, welches die unternehmerischen Fragestellungen einer intersubjektiv nachvollziehbaren und monetären Humankapitalbewertung beantwortet. Die betriebswirtschaftlichen Instrumentarien, welche für die Unternehmensbilanzierung von Real- und Finanzkapital entwickelt wurden, und sich bis in die Gegenwart für diese assets bewährt haben, greifen für das immaterielle Humankapital nicht.Die betriebswirtschaftliche Literatur zu dem Thema und Stellungnahmen der Wirtschaftspraxis belegen die Probleme, welche schon entstehen, wenn es darum geht zu klären was eigentlich Humankapital ist. Wie kann es umfassend spezifiziert werden Welche Attribute beschreiben es vollständig In welcher Form kann es abgegrenzt und schließlich bewertet werden In deren Folge stellt sich die Problematik, ob diese Fragen überhaupt objektiv beantwortet werden können. Humankapital ist unter ökonomischen Überlegungen wirkliches Kapital. Mindestens seit Gery S. Becker kann dieser Terminus fundiert auf humanes Leistungsvermögen angewendet werden.Im Unterschied zu Realkapital folgt das Humankapital, 104 pp. Deutsch.
-
REITS - Ein Modell für Deutschland?
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600412 ISBN 13: 9783836600415
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,9, Technische Universität Dresden (Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Volkswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die Immobilienanlagemärkte befinden sich in einem fundamentalen Umbruch. Im Zuge der Globalisierung und der steigenden Professionalität der Akteure gewinnt der Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle an Einfluss. In diesem Kontext verzeichnen Real Estate Investment Trusts (REITs) als attraktives und international anerkanntes Anlageinstrument für private sowie institutionelle Investoren neben den bestehenden indirekten Immobilienanlageformen einen Bedeutungszugewinn. Das Modell des REITs stammt ursprünglich aus den USA und wurde 1960 gesetzlich aufgelegt. Hauptkriterium dieses indirekten Immobilienanlageinstrumentes ist seine Steuerbefreiung auf Gesellschaftsebene, welche mit einer Verpflichtung zu hohen Ausschüttungsquoten verbunden ist. Mittlerweile hat sich dieses Anlageprodukt nicht nur etabliert, sondern zu einem internationalen Standard entwickelt. Zurückzuführen ist diese Tatsache auf die attraktiven Eigenschaften des REITs. Er besitzt eine sehr hohe Fungibilität, ist steuertransparent und verfügt neben seinem ausgezeichneten Rendite-Risiko-Profil, aufgrund seiner Korrelationseigenschaften über ein großes Diversifikationspotential. Bisher wurden REIT-Konstrukte weltweit in 19 Ländern aufgelegt. Die Sequenz der Neueinführungen verzeichnete in den letzten Jahren eine deutlich steigende Tendenz, welche sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird. Besonderes Augenmerk liegt deshalb auf der REIT-Einführung in Deutschland, welches das größte Immobilienvermögen in Europa besitzt. Neben der direkten Immobilienanlage stehen den Anlegern dort mehrere indirekte Immobilienanlageprodukte zu Verfügung. Dabei besitzen Offene und Geschlossene Immobilienfonds das größte Marktvolumen. Ihre große Beliebtheit ist auf ihre Steuertransparenz und ihre hohe Sicherheit durch die Verankerung im Investmentgesetz (InvG) zurückzuführen. Die Abhängigkeit von Mittelzu- und -abflüssen, welche eine Illiquidität bewirken können, stellt jedoch ein Problem der Offenen Immobilienfonds dar. Die Immobilienaktiengesellschaften als weiteres Investmentvehikel haben hingegen nur eine untergeordnete Bedeutung. Trotz der Abgrenzung zu Immobilienfonds durch hohe Fungibilität der Anteile sowie geringe Regulierung, sind Immobilienaktien bisher nur ein Nischenprodukt am Kapitalmarkt. Aufgrund der latenten Liquiditätsprobleme Offener Immobilienfonds und der fehlenden Etablierung der Immobilienaktiengesellschaften intensiviert sich in Deutschland die Diskussion um die Einführung einer steuertransparenten, kapitalmarktfähigen Gesellschaft in Form eines REITs. Die Einführung erhält zusätzlichen Druck durch den internationalen Wettbewerb um die Anlagegelder der Investoren, in dem Deutschland nicht ins Hintertreffen geraten sollte. Es wird sich deshalb der Auflegung einer REIT-Struktur schwer entziehen können. Dabei besteht für Deutschland die Chance, einen REIT zu konstruieren der nicht die Fehler bereits in der Vergangenheit aufgelegter Modelle aufweist. Gang der Untersuchung:Zielstellung dieser Arbeit ist es die Notwendigkeit der Einführung von REITs in Deutschland zu prüfen und Lösungsvorschläge für die gesellschafts- und steuerrechtliche Ausgestaltung dieses Anlagevehikels zu geben. Nach einer Einführung in das Modell der REITs werden in Kapitel drei die indirekten Immobilienanlageprodukte, offene Immobilienfonds und Immobilienaktiengesellschaften betrachtet. Dabei wird nach einer modellhaften Vorstellung ein Vergleich zum REIT anhand von qualitativen und quantitativen Eigenschaften durchgeführt. Anschließend folgt in Kapitel vier eine Analyse der REIT-Modelle bedeutender Länder. Unter Nutzung dieser Ergebnisse wird im letzten. 132 pp. Deutsch.
-
Haben hoch-freizeitaktive Eltern hoch-freizeitaktive Kinder?
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600250 ISBN 13: 9783836600255
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Magisterarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Pädagogik - Familienerziehung, Note: 1,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel (Philosophische Fakultät, Pädagogik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Hauptgegenstand dieser im freizeitpädagogischen Bereich anzusiedelnden Arbeit ist die Frage nach dem elterlichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder bezüglich deren Interesses an Freizeitaktivitäten und ihrer praktischen Ausübung. Die Fragestellung der Arbeit ( Haben hoch- freizeitaktive Eltern hoch- freizeitaktive Kinder ), die eigentlich nur mit ja oder nein zu beantworten wäre, wirft die Frage nach den Gründen dafür auf: Spielen die Einstellung und die eigene Freizeitaktivität der Eltern eine Rolle Welchen Einfluss haben die Umgebung und der Grad der Anregung in Bezug auf Freizeitaktivitäten auf das Freizeitverhalten des Kindes Im Blickpunkt von zahlreichen Untersuchungen der traditionellen Familienforschung steht die Frage, warum sich Kinder in bestimmte Richtungen entwickeln und inwieweit die Erziehung und das Verhalten der Eltern diesen Vorgang beeinflussen. Es wird nach Vorhersagemöglichkeiten gesucht, die ein verlässliches Maß an Richtigkeit besitzen, um Aussagen über mögliche kindliche Entwicklungstendenzen basierend auf elterlichen Einflussgrößen machen zu können.Im Vergleich zu derartigen Untersuchungen erfolgen bei dieser Arbeit zwei wichtige Eingrenzungen: Die thematischen Schwerpunkte liegen im Hinblick auf den Hauptgegenstand zum einen auf der Bedeutung der Eltern und ihrer Aktivität in der Freizeit hinsichtlich ihres Einflusses auf die Freizeitaktivität ihrer Kinder und zum anderen auf der Freizeitaktivität der Kinder selbst. Trotz dieser Eingrenzungen bedarf es der Berücksichtigung der Familienforschung mit ihren Theorien und Modellen, die die elterlichen Einflussfaktoren auf ihre Kinder in Erziehungs- und Sozialisationsprozessen zu erläutern versuchen. Aus ihnen können die eigenen theoretischen Begründungen von Zielen, Planungsaspekten, Durchführungsmethoden und Ausführungskriterien abgeleitet werden.Aufgrund der thematischen Eingrenzung auf die Rolle und Funktion der Eltern im Erziehungs- und Sozialisationsprozess auf den Bereich der Freizeit ist eine spezielle Darstellung sowohl der Familiensituation als auch des Freizeitbegriffes, auch in historischer Perspektive, notwendig.Im ersten Kapitel werden daher die Problemfelder Familie , Freizeit und Sozialisation unter Berücksichtigung verschiedener Sozialisationsmodelle behandelt, auf deren Grundlage ein Modell zur familialen Freizeitaktivität entwickelt wird. Voraussetzung für das Modell ist, dass es für eine empirische Untersuchung operationalisierbar ist. Es werden daraus Arbeitshypothesen abgeleitet, die eine Zielorientierung für die empirische Untersuchung darstellen.Im zweiten Kapitel erfolgen die methodischen Vorüberlegungen zur Entwicklung des Fragebogens, durch den die relevanten Daten zum Themenkomplex Elterliche Einflussfaktoren für die Freizeitaktivität ihrer Kinder ermittelt werden können. Es wird daher auf die Versuchspersonen, die Operationalisierung der Modellkomponenten und die Erarbeitung und Gliederung von Fragen zur Datenerhebung eingegangen. Nach Überprüfung des Fragebogens anhand der Gütekriterien endet das Kapitel mit der Formulierung statistischer und inhaltlicher Hypothesen.Das dritte Kapitel stellt die Ergebnisse der Erhebung unter Berücksichtigung verschiedener Analysemethoden dar.Abschließend werden im vierten Kapitel die statistischen Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit diskutiert und bezüglich der Bestätigung oder der Nichtbestätigung der verschiedenen Arbeitshypothesen zusammengefasst, bevor eine kritische Betrachtung des angewandten Modells stattfindet. Im Anhang befinden sich neben zwei Übersichten zur Freizeitbezogenen Opera. 136 pp. Deutsch.
-
Untersuchung von Methoden zur Verarbeitung digitaler Bilder von Fingerabdrücken
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836650509 ISBN 13: 9783836650502
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1,7, Fachhochschule Dortmund (Informatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Was ein Fingerabdruck ist, weißt jeder. Jeder Mensch besitzt Fingerabdrücke auf den Handflächen und Fußsohlen. Doch das Erstaunliche dabei ist, dass jeder einzelne Finger jedes Menschen seinen einzigartigen individuellen Abdruck hat. Es reicht schon einen Blick auf die eigenen Fingerkuppen zu werfen. Die Rillenlinien verlaufen an allen Fingern sowohl von linker als auch von rechter Körperseite unterschiedlich. Es gibt auch kein symmetrisches bzw. spiegelverkehrtes Linienbild. Die Fingerabdrücke sind nicht genetisch bedingt, was auch die Unterscheidung bei eineiigen Zwillingen erklärt. In riesigen Datenbeständen mit mehreren Millionen Fingerabdrücken wurden bis heute noch keine identischen gefunden. Doch all diese Phänomene sind nicht nur unerforschte Geheimnisse der Natur, die man bewundern oder genießen könnte. Die Informationsmerkmale der Fingerabdrücke können dazu verwendet werden, Personen zu identifizieren. Mit der Entwicklung der Computertechnik, Erfindung neuer Materialien und mathematischer Algorithmen ist es gelungen, intelligente Personenidentifikationssysteme zu realisieren. Dank einfachem Aufbau, mobiler Einsatzmöglichkeit, schnellerer Bearbeitungszeit und geringeren Kosten, werden sich Fingerabdruck-Erkennungsgeräte immer weiter in menschlichen Alltagsleben verbreiten. Problemstellung:- Einarbeitung in die gängigen Algorithmen der Fingerabdruckerkennung. - Auswahl eines Algorithmus und Aufteilung des gesamten Erkennungsablauf in einzelne logische Bearbeitungsschritte.- Implementierung der Bearbeitungsschritte als separate Funktionen .- Untersuchung der bekannten Segmentierungs- und Skeletierungsalgorithmen und Umsetzung der relevanten davon.- Entwickelung einer Benutzeroberfläche für den kompletten Erkennungsablauf mit allen dazugehörigen Funktionalitäten und zusätzlichen Einstellungen, wobei jeder Schritt visuell dargestellt werden soll.- Markierung der lokalisierten Merkmale des Fingerabdrucks im Bild, Klassifizierung und Speicherung diese in eine Text-Datei.- Untersuchung und Bewertung der Algorithmen anhand von Beispielen.Gang der Untersuchung:Kapitel 2 beschäftigt sich allgemein mit der Thematik der biometrischen Identifikation mittels Fingerabdruckerkennung. Am Anfang dieses Kapitels wird ein Rückblick auf die Geschichte gegeben. Es werden grundlegende Begriffe erklärt. Im Weiteren informiert das Kapitel über ein typisches Erkennungssystem und dessen Aufbau. Außerdem werden verschiedene Einsatzgebiete vorgestellt. Kapitel 3 bildet den Hauptteil dieser Arbeit und geht einen Schritt weiter in die Welt der Fingerabdruck-Technologie. Es stellt ausführlich alle einzelnen Komponenten eines ausgewählten Fingerabdruckerkennungsalgorithmus vor, der mit Hilfe bestimmter Methoden der digitalen Bildverarbeitung das Lokalisieren von Minutien realisiert. Zum besseren Verständnis werden sämtliche Abschnitte des Kapitels von zahlreichen Beispielsbildern begleitet. Darüber hinaus werden einige alternative Ansätze vorgestellt. Kapitel 4 stellt zum Vergleich ein weiteres modernes Fingerabdruckerkennungsverfahren vor. Neben dem Grundprinzip und der allgemeinen Vorgehensweise wird auch die mögliche Realisierung diskutiert.Kapitel 5 beschreibt die Aufgaben und Funktionsweise einer Software, die zur visuellen Darstellung des Fingerabdruckerkennungsalgorithmus entwickelt wurde.Die Testergebnisse werden in Kapitel 6 präsentiert und analysiert. Anhand der Beispiele werden aufgetretene Schwierigkeiten erläutert sowie Verbesserungsmöglichkeiten untersucht.Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem kurzen Ausblick ab.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichn. 92 pp. Deutsch.
-
Entwicklungsprozess eines neuen Produkts im Passivgeschäft einer Automotivebank
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600587 ISBN 13: 9783836600583
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,7, VWA-Studienakademie (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die modernen Dienstleistungs-Produktentwicklungs-Ansätze, die zentrales Thema der vorliegenden Arbeit sind, befassen sich nicht nur ausschließlich mit Entwicklungsverfahren, sondern beschäftigen sich zumeist auch mit dem kompletten Entwicklungssystem, um dadurch umfassende Lösungskonzepte für die Entwicklung von Produkten im Dienstleistungssektor bereitstellen zu können. Dieser Ansatz gilt um so mehr für Service Engineering, da es sich hierbei für viele Unternehmen um gänzlich neue Aufgabenstellungen handelt und deshalb insbesondere die Einführung und Integration der Dienstleistungsentwicklung in Unternehmen mit einer Reihe von offenen Fragestellungen verbunden ist. Das Ziel dieser Arbeit soll sein, ein neues Produkt für den Einlagenbereich der DaimlerChrysler Bank als Finanzdienstleister zu entwickeln und das Konzeptdes Service Engineering, die Systematik sowie die geeignete Methodik und die einzelnen Prozessschritte zu erläutern. Das Produkt ist für den Einlagenbereich bzw. auch Passivbereich genannt, (fest- oder variabel verzinslich) bestimmt. Zum besseren Verständnis des weiteren Textes soll an dieser Stelle der Begriff Verzinsliche Wertpapiere definiert werden. Die Verzinslichen Wertpapiere, oft auch Anleihen, Renten, Bonds, oder Obligationen genannt, sind auf den jeweiligen Inhaber bestimmte Schuldverschreibung; d. h. der Käufer solcher Schuldverschreibung besitzt eine Forderung gegenüber dem Emitenten. Gang der Untersuchung:Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile; der erste Teil befasst sich mit allgemeinen und grundsätzlichen Einordnungen. So wird die DaimlerChrysler Bank mit ihrer Produktpalette (insbesondere der Einlagenbereich) vorgestellt. Des weiteren wird ausgeführt, dass die Produktentwicklung ein Teilaspekt des Marketings ist; das Dienstleistungsmarketing und im speziellen das Bankenmarketing für den Einlagenbereich wird vorgestellt.Im zweiten Teil wird auf die Thematik der Produktentwicklung im Dienstleistungsbereich eingegangen; vertieft wird die Thematik des Service Engineering. Im weiteren wird anhand eines ausgewählten Entwicklungsmodells dann ein neues Produkt für den Einlagenbereich der DaimlerChrysler Bank zur Marktreife entwickelt.Die Thematik der Entwicklung neuer Dienstleistungen ist auch im Bereich der Dienstleistungsforschung lange Zeit ein weitgehend vernachlässigtes Feld. Zwar tauchen in der anglo-amerikanischen Literatur in den 70er- und 80er-Jahren eine Reihe erster wissenschaftlicher Arbeiten zu New Service Development auf, jedoch sind diese in ihrer Summe eher als rudimentär zu bezeichnen. Parallel zum amerikanischen New Service Development wurde Mitte der 90er-Jahre in Deutschland der Begriff Service Engineering geprägt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Problemstellung22.Grundl egendes und begriffliche Differenzierungen62.1Banken und Direktbanken62.2Die DaimlerChrysler Bank und ihre Einlagenprodukte92.3Begriff und Bedeutung des Marketing122.4Besonderheiten der Dienstleistung gegenüber Sachgütern152.5Marketingaspekte für Einlagenprodukte173.Produktgestaltung bei Dienstleistungen223.1Organisation von Dienstleistungsmanagement223.2Methodik des Service Engineering253.3Vorgehensmodelle zur Produktentwicklung293.3.1Rahmenparameter für das Passivprodukt.343.3.2Ideenfindungsprozess363.3.3Prototypingprozess413.4Ausst attungsmerkmale des neuen Elegance 3 Plus 463.5Fazit48Anhang501.DaimlerChrysler Bank Tagesgeldkonto502.Mercedes-Benz Vaneo Sparplan523.DaimlerChrysler Bank Sparplan (Spareinlage nach RechKredV)56Aussc. 68 pp. Deutsch.
-
Die Bilanzierung von Pensionsrückstellungen und die Auswirkungen ihrer Auslagerung
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600269 ISBN 13: 9783836600262
Seller: Rheinberg-Buch Andreas Meier eK, Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftliches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Auch im Jahr 2005 setzte sich der Trend fort, dass deutsche Unternehmen zunehmend ihre unmittelbaren Pensionsrückstellungen aus der Bilanz auslagerten. Dabei wurde vor allem die Auslagerung auf ein CTA (Contractual Trust Arrangement) bevorzugt. Bekannteste aktuelle Beispiele aus der Presse waren BASF und Henkel, die im Jahr 2005 ein Großteil ihrer Pensionsverpflichtungen auslagerten. Im Jahr 2006 werden weitere folgen, wie u. a. die E.ON AG, Continental, die Deutsche Börse AG, MAN und die Heidelberger Druckmaschinen AG ankündigten. Die Gründe und Ursachen dafür sind vielfältig und zum Teil unternehmensspezifisch. Die Zusammenhänge und Auswirkungen die zu einer solchen Auslagerung der Pensionsrückstellungen führen, sollen in dieser Diplomarbeit beleuchtet werden. Weiterhin soll untersucht werden, in welchem Umfang DAX Unternehmen bereits eine externe Finanzierung ihrer Pensionsrückstellungen nutzen und welche Form der Auslagerung am wirkungsvollsten ist. Im internationalen Vergleich ist es bereits üblich, Pensionsverbindlichkeiten an externe Versorgungsträger zu übertragen. Somit erhöht eine Auslagerung die Vergleichbarkeit deutscher Unternehmen zu ihren internationalen Konkurrenten. Aber auch Basel II, die seit 2005 verpflichtende Bilanzierung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) für börsennotierte Unternehmen und die Politik der Ratingagenturen, Pensionsrückstellungen als Fremdkapital zu bewerten, beeinflussen die Entscheidung Pensionsrückstellungen auszulagern. Die weltweite Ausrichtung vieler deutscher Unternehmen zwingt diese, ihre Organisation und ihre Rechnungslegung an internationale Standards anzupassen. Neben der Internationalisierung der Wirtschaft ist aber auch die demographische Entwicklung der Bevölkerung ein wichtiger Grund, warum sich gerade jetzt so viele Unternehmen Gedanken über die Finanzierung ihrer Pensionszusagen machen. Durch höhere Lebenserwartungen steigen die Pensionsrückstellungen an und die gesetzliche Rentenversicherung kann durch ihre Umlagefinanzierung den Lebensstandard im Alter nicht mehr sichern. Daher kommt auf die Unternehmen mittels der betrieblichen Altersversorgung (bAV) Verantwortung zu, die notwendige Verbesserung der Alterssicherung mit zu gestalten.Gang der Untersuchung:Um in das Thema einzuführen werden in Kapitel 2 die Grundlagen der Rechnungslegung von Pensionsrückstellungen nach HGB, IFRS und nach den US-amerikanischen General Accepted Accounting Principles (US-GAAP) betrachtet und miteinander verglichen.Kapitel 3 geht dann genauer auf die fünf Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung ein. Die Direktzusage ist davon der unmittelbare Durchführungsweg, die Unterstützungskasse, die Pensionskasse, die Direktversicherung und der Pensionsfond sind mittelbare Durchführungswege über einen externen Versorgungsträger. Dabei kommt dem neu geschaffenen Durchführungsweg Pensionsfond eine besondere Gewichtung zu.Vor dem Hintergrund der Rechnungslegung wird dann in Kapitel 4 untersucht, welche Vorteile die Auslagerung hat und welcher Durchführungsweg für die Auslagerung am sinnvollsten ist. Dabei hat sich vor allem die Treuhandlösung bzw. CTA als sehr praktikabel erwiesen, obwohl dies gar kein Wechsel des Durchführungsweges notwendig macht. Aber auch die Auslagerung auf einen Pensionsfond, die vom Gesetzgeber besonders gefördert wird, wird genauer betrachtet. In Kapitel 5 wird anschließend die Praxis der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen anhand aller DAX Unternehmen untersucht und näher beleuchtet, wie internationale Unternehmen dabei vorgehen.Konkret werden dann in K. 112 pp. Deutsch.
-
Verdeckte Einlage im Steuer- und Gesellschaftsrecht
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600595 ISBN 13: 9783836600590
Seller: Rheinberg-Buch Andreas Meier eK, Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,7, Fachhochschule Worms (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das Handelsrecht versteht unter Einlagen Vermögenszuführungen (Geld- oder Sachleistungen), die ein Gesellschafter einer Gesellschaft in Erfüllung der gesellschafsrechtlichen Verpflichtungen zur freien Verfügung überlässt. Erfolgt die Einlage gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, so handelt es sich um eine offene Einlage. Bei einer Kapitalgesellschaft ist das bei der Gründung oder bei einer Kapitalerhöhung der Fall. Steuerlich sind Einlagen gem. 4 Abs. I S. 5 EStG alle Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres zugeführt hat. Erfolgt eine Einlage nicht auf einer gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung zur Kapitalaufbringung, sondern erfolgt diese entweder ohne Rechtspflicht oder ohne einer schuldrechtlichen Verpflichtung bezeichnet man solche Einlagen als verdeckte Einlagen. Die offenen Einlagen wirken sich weder handelsrechtlich noch steuerrechtlich gewinnerhöhend aus. Bei den vE ist die Behandlung in den beiden Bilanzen differenzierter zu betrachten und kann zu divergierender Beurteilung führen. Nach h. M. sind diese handelsrechtlich in die Kapitalrücklage gem. 272 Abs. II Nr. 4 HGB einzustellen. Die vE können jedoch auch als Ertrag in der GuV gem. 275 Abs. II Nr. 4 und 15 bzw. Abs. III Nr. 6 und 14 HGB auszuweisen sein. Steuerlich sind sowohl die offenen als auch die vE erfolgsneutral zu behandeln. Soweit die vE als Ertrag handelsrechtlich behandelt wurde, so ist diese steuerlich ausserbilanziel wieder von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft abzuziehen. Die Definition der vE ist an keiner Stelle weder im Handelsrecht noch im Steuerrecht gesetzlich definiert. Im Unterschied zur verdeckten Gewinnausschüttung wird die vE im Gesetz nicht einmal erwähnt. Oft wird diese lediglich als Pendant zur verdeckten Gewinnausschüttungen gesehen und nicht immer wird eine übergreifende Betrachtung der Auswirkungen bei der Gesellschaft und/oder dem Gesellschafter von verdeckten Einlagen in ausreichendem Maße vorgenommen. Die Möglichkeiten der Konstellationen betreffend der vE sind mannigfaltig und überwiegend von der Rechtsprechung geprägt. Das Spektrum der Problemfelder ist ebenfalls breit gestreut. Das betrifft beispielsweise die Bewertung der vE, die Unterschiedliche Behandlung beim Gesellschafter in Hinsicht auf den Einlagegegenstand sowie den Zeitpunkt der Einlage, die divergierende Zugehörigkeit der Beteilung und des einzulegenden Wirtschaftsgutes in Bezug auf Betriebs- und/oder im Privatvermögen usw. Die vE wird in der deutschen Steuerrechtsprechung unzureichend gewürdigt so dass es immer wieder zu einer Fehleinschätzung der Rechtslage kommt. Die vorliegende Arbeit versucht die einzelnen Problembereiche als auch die Lösungsansätze sowohl auf der Seite der Gesellschaft als auch auf der Ebene des Gesellschafters systematisch darzustellen. Dabei beschränkt sich die Arbeit auf der Seite der Gesellschaft auf die Rechtsform der GmbH.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIAbbildungsverzeichnisIVAbkürzungsverzeichnisV1.Allg emeines12.Begriffsdefinitionen32.1Allgemeines32.1.1Das Trennungsprinzip32.1.2Die Besteuerungsebenen42.2Einlagen52.2.1Einlagen und Entnahmen in ein Einzel- bzw. Personenunternehmen und in eine Körperschaft52.3Offene Einlagen72.3.1Definition72.3.2Gegenstand82.3.3Behandlung der offenen Einlage bei der Kapitalgesellschaft92.3.4Behandlung der offenen Einlagen bei dem Gesellschafter102.4Verdeckten Einlage102.4.1Definition102.4.2Gegenstand der verdeckten Einlage112.4.3Unentgeltlichkeit der verdeckten Einlage122.4.2. 112 pp. Deutsch.
-
Was ist mit der Umsetzung der Jungenarbeit in die Praxis?
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600218 ISBN 13: 9783836600217
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Magisterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Sonstiges, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Erziehungswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die ersten Konzepte geschlechtsbewusster Jungenarbeit entstanden in Anlehnung an die Arbeit mit Mädchen in den Achtziger Jahren. Unter dem Einfluss der Frauenbewegung dachten auch Männer verstärkt über ihre traditionelle Geschlechterrolle nach und entdeckten sie als ein wichtiges Thema in der Arbeit mit Jungen. In den Neunziger Jahren entwickelten sich dann eine Reihe von Konzepten, Methoden und Sichtweisen. Zunehmend wurde deutlich, dass die Jungen nicht nur die Gewinner des Geschlechterkampfes sind, sondern selbst Opfer und Verlierer in der Auseinandersetzung mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen.Das Thema Geschlechterverhältnisse wird im fachwissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs nicht mehr nur in Bezug auf die Benachteiligung von Mädchen und Frauen interessant. Seit geraumer Zeit wird auch der Situation von Jungen und Männern Aufmerksamkeit geschenkt. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Probleme der männlichen Identitätsbildung angesichts des Wandels der gesellschaftlichen Geschlechterordnung und der Infragestellung veralteter Leitbilder. Traditionelle Formen von Männlichkeit haben an Legitimität eingebüßt, ohne dass gleichzeitig ein klares und positives Bild zeitgemäßer Männlichkeit zur Verfügung gestellt wird, an dem sich Jungen und Männer orientieren können.Ursprünglich wollte ich mich in dieser Magisterarbeit mit den unterschiedlichen Konzepten in der Jungenarbeit auseinandersetzen, diese miteinander vergleichen und auf ihre Praxistauglichkeit überprüfen. Während der Beschäftigung mit diesem Thema stellte sich mir dann aber die Frage: Wo gibt es Jungenarbeit überhaupt in der Praxis Warum wird sie so wenig umgesetzt Worin liegen die Gründe und Schwierigkeiten Diese Fragen stellten sich mir während der gesamten Literatursuche immer wieder. Im Laufe meines Studiums und verschiedener Praktika in der Jugendarbeit und Jugendhilfe begegnete mir geschlechtsspezifische Erziehungsarbeit leider nie. Aus diesem Grund ist die Generalfragestellung meiner Magisterarbeit: Was ist mit der Umsetzung der Jungenarbeit in die Praxis Hintergründe und Beweggründe. Eine theoretische Reflexion.Empirische Forschungen belegen, dass bestimmte Gesichtspunkte der Lebenssituation Jugendlicher wie Freizeit, Lebensstil und Handlungsmuster sowie Gewaltbereitschaft und Kriminalität ohne Rücksichtnahme auf das Geschlecht nicht angemessen erfasst werden können. Somit muss in Theorie und Praxis die allgemeine Rede von Jugend durch eine differenzierte Betrachtung von Mädchen und Jungen ersetzt werden. Parallel dazu wird häufig die Meinung vertreten, geschlechtsspezifische Pädagogik sei überflüssig geworden, weil sich Jungen und Mädchen frei und unabhängig von geschlechtsspezifischen Rollenbildern entfalten könnten.Geschlechtsdifferenzierte Pädagogik würde die traditionellen Männer- und Frauenrollen nur festschreiben und schließlich verhärten. Bildungsinstitutionen, Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Schulen haben dieses Thema aufgegriffen. Während sich die Mädchenarbeit flächendeckend etabliert hat, wurde die Notwendigkeit von Jungenarbeit bereits festgestellt, mancherorts umgesetzt und meistens immerhin für wichtig gehalten. Einrichtungen, die Angebote ausschließlich für Jungen anbieten, gibt es nur wenige und diese sind sehr unterschiedlich verteilt. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg verfügen bereits über ganze Netzwerke Jungenarbeit . In den neuen Bundesländern gibt es jedoch kaum Adressen.Eine mit der Mädchenarbeit vergleichbare Umsetzung hat also nicht stattgefunden trotz der längst etablierten Forschung zur . 80 pp. Deutsch.
-
Irish English: Frank McGuinness - Anne Devlin - Roddy Doyle - Vincent Woods
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600188 ISBN 13: 9783836600187
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diploma Thesis from the year 2004 in the subject English Language and Literature Studies - Literature, grade: 1,0, Johannes Gutenberg University Mainz (Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie), language: English, abstract: Inhaltsangabe:Abstract:Irish English (hereafter abbreviated as IE) has been the subject of many previous studies, dealing primarily with history, grammar, pronunciation and lexicon. Many works have also been published about the English language used in works of famous Anglo-Irish authors such as Swift, Synge or Joyce. However, little research exists on the English language used in works by contemporary Irish authors. The purpose of this paper is to give an idea of what modern written IE is like.In this paper four plays by contemporary Irish authors (all born between 1950 and 1960) will be analysed with regards to pronunciation, grammar, lexicon and manners of speech. These plays are: - The Factory Girls by Frank McGuinness.- After Easter by Anne Devlin.- Brownbread by Roddy Doyle.- At The Black Pig s Dyke by Vincent Woods.As will be discussed later on, IE is not a common dialect, but regionally different, especially between the northern and the southern part of the island.In order to point out some dialect variation, the plays were selected according to their settings, which were County Donegal, Belfast, Dublin and County Leitrim.This paper will be divided into two parts. In the first part, I would like to give a theoretical overview of the various aspects of IE, such as grammar, pronunciation, lexicon and manners of speech, and how they differ from Standard English (henceforth abbreviated as SE). I will commence by providing a historical overview on how and when the English language came to Ireland, which is essential for understanding the further development of the different dialects and accents. This introductory overview is followed by IE pronunciation and grammar in comparison to RP and SE respectively. Subsequently, the lexicon of IE and certain manners of speech, such as exaggeration, will be considered. The second part will comprise the analyses of the four plays, which were carried out on the basis of those features of IE outlined in the theoretical part. The analyses will provide a short summary of the respective play, and present relevant examples from the plays. Evidently, there are more typically Irish features in the text corpus, however these are not investigated here. The second part will conclude with a comparison of the findings of the four plays.Inhaltsverzeichnis:Table of Contents:1.Introduction3Part I.52.The advance of the English language in Ireland across the centuries53.Linguistic characteristics of Irish English174.Lexicon425.Manners of speech43Part II.451.The Factory Girls452.After Easter573.Brownbread694.At The Black Pig s Dyke845.Conclusion996.Works consulted101Textprobe:Text Sample:Chapter IV, Lexicon: With the influence of Irish as well as old English and Scots dialects it seems only natural that a certain number of distinctive vocabulary should have come to pass. The great number of these words and phrases can be divided into two categories: words of Irish origin, and words of English (including Scots) origin.1 These two categories can then be further subdivided. Words of Irish origin are mostly loanwords of which the meaning is carried over into Irish English. Quite often, the spelling of these Irish words has been anglicised, as in smithereens from smidiríní, or macushla from mo chuisle . In the Republic of Ireland, Irish words are generally used for political institutions, such as Taoiseach (the Prime Minister), Dáil (the parliament), or political parties, such as Fianna Fáil, Fine. 116 pp. Englisch.
-
Russland als Zielland für IT-Offshoring-Projekte im Vergleich mit Indien
Published by Diplom.De Dez 2006, 2006
ISBN 10: 3836600498 ISBN 13: 9783836600491
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Masterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 2,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Der Begriff offshore geht auf die 70er und 80er Jahre zurück, als US-amerikanische Unternehmen einfache Datenerfassungsdienste auf die karibischen Inseln zwecks Kosteneinsparungen verlagerten. Heute versteht man unter Offshoring das Auslagern von Prozessen und Funktionen in die Länder, die in der Regel über günstigere Rahmenbedingungen, insbesondere bei den Arbeitskosten, verfügen.Die Verlagerung der Produktion in andere Länder ist allerdings nicht neu. Bereits in den 60er und 70er Jahren wurde Produktion aus dem verarbeitenden Gewerbe im großen Umfang ausgelagert. Neu dagegen ist, dass nicht nur Produktion sondern auch Dienstleistungen in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten erbracht und von dort importiert werden. Ein Grund hierfür ist das enorme Wachstum des Dienstleistungsanteils im gesamten Wirtschaftssektor. Neben der positiven Entwicklung des Anteils der Dienstleistungen am gesamten Wertschöpfungsprozess nimmt der Anteil der Dienstleistungen immer stärker zu, bei denen der persönliche Kontakt zwischen Produzent und Konsument nicht mehr erforderlich ist, vor allem bei IT - gestützten Dienstleistungen ist dies häufig der Fall. Dank moderner Internet- und Kommunikationstechnologien lassen sich selbst komplexe Aufträge problemlos bis auf die andere Seite des Globus vergeben.Offshoring bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Lohnkostenniveaus in verschiedenen Ländern in Projekten oder Produktionsprozessen zu kombinieren, was die Produktionskosten insgesamt senkt und damit zu einer verstärkten Wettbewerbsfähigkeit der so entstehenden Produkte bzw. Prozesse führt. In den Offshoring - Regionen werden zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet, die auch für importierte Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden. Offshoring kann somit durch die Einkommensströme auch den Export in diesen Ländern fördern.IT - Offshoring entwickelte sich aufgrund des Fachkräftemangels in der IT - Industrie. Die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in Westeuropa und den USA führte allerdings nicht dazu, dass diese Tätigkeiten zurückverlagert wurden, denn zwischenzeitlich haben viele Unternehmen positive Erfahrungen mit dieser Art der internationalen Zusammenarbeit gemacht. Vor allem werden durch IT - Offshoring eine Konzentration auf Kernkompetenzen, bessere Planbarkeit von Prozessen und Abläufen, Zugriff auf aktuelle Technologien, Erhöhung der Datensicherheit sowie kürzere Reaktionszeiten auf Marktänderungen ermöglicht. Weiterhin gelten Standardisierung der Prozesse, Optimierung des Developments und des Qualitätsmanagements, Zugang zu innovativem Entwicklungs- und Methoden-Know-how, schnellere Durchsetzung von Veränderungsprozessen, Produktivitätssteigerung und Leistungsanreize, höhere Flexibilität sowie Qualität der Leistungen, Verringerung des Personalbedarfs im eigenen IT - Bereich, raschere Verfügbarkeit von Spezialisten und dadurch Vermeidung von Beschaffungsproblemen qualifizierter Fachkräfte als wichtige Offshoring - Pro- Argumente. Offshoring führt darüber hinaus zu einer Veränderung der Anforderungen an IT - Arbeitsplätze in den Unternehmen. Die Mitarbeiter in den IT - Abteilungen werden künftig selbst weniger die reine Programmierung durchführen, sondern vermehrt koordinierende und leitende Funktionen übernehmen, was zu einer Höherqualifizierung einzelner Tätigkeiten führt. Dies setzt allerdings voraus, dass die Unternehmen und ihre Mitarbeiter flexibel auf die neuen Anforderungen reagieren und ihre Fähigkeit entwickeln, sich schnell auf neue Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt einzustellen. Dabei spielen hohe kulturelle Loyalität und Integrationsfähigkeit eine große Rolle. Außerdem . 100 pp. Deutsch.