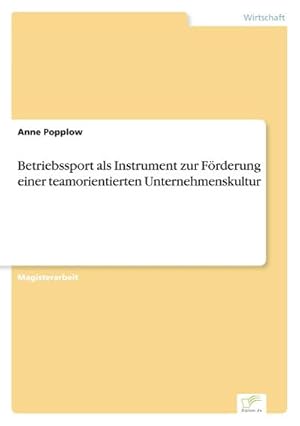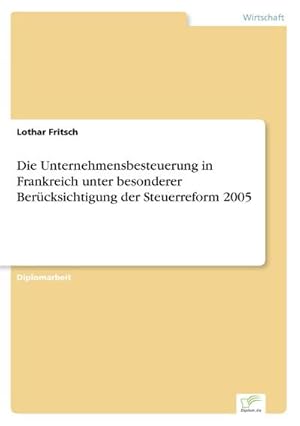diplom de mai 2005 (53 results)
Product Type
- All Product Types
- Books (53)
- Magazines & Periodicals
- Comics
- Sheet Music
- Art, Prints & Posters
- Photographs
- Maps
- Manuscripts & Paper Collectibles
Condition
- All Conditions
- New (53)
- Used
Binding
- All Bindings
- Hardcover
- Softcover (53)
Collectible Attributes
- First Edition
- Signed
- Dust Jacket
- Seller-Supplied Images (53)
- Not Print on Demand
Free Shipping
- Free US Shipping
Seller Location
Seller Rating
-
Elektronische Zahlungssysteme
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 383868737XISBN 13: 9783838687377
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 2,3, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule (Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Elektronische Zahlungssysteme spielen heutzutage eine entscheidende Rolle. Neben Flexibilität und Verfügbarkeit geben sie dem Kunden im B2C Bereich ein gewisses Maß an Freiheit. Mit der freien Entscheidung, aus verschiedenen elektronischen Zahlungssystemen wählen zu können, stellt sich nicht nur für Kunden, sondern auch für Händler die Frage nach dem geeignetsten Zahlungssystem. Welches der elektronischen Zahlungssysteme ist aber das sicherste und beste Gibt es überhaupt ein bestes Zahlungssystem oder macht nur die richtige Kombination verschiedener Zahlungssysteme das beste Zahlungssystem aus Spielt es bei der Auswahl des besten Zahlungssystems eine Rolle, ob der Händler seine Ware in einem Geschäft mit Öffnungszeiten oder über das Internet verkauft Mittlerweile gibt es ein breites Spektrum an verschiedenen Zahlungssystemen. Einige können sich durchsetzen, andere nicht. Warum ist dies so Warum genießen einige Zahlungssysteme weltweite Akzeptanz und andere verschwinden eine Woche nach der Einführung wieder Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche Anforderungen ein elektronisches Zahlungssystem erfüllen muss, um weltweite Akzeptanz im B2C Bereich zu bekommen. In diesem Rahmen werden klassische elektronische Zahlungssysteme vorgestellt, bewertet und verglichen. Dabei wird auf rechtliche Grundlagen und die wirtschaftliche Bedeutung für Händler und Kunden eingegangen. Die Bewertung erfolgt anhand vorher festgelegter Kriterien, so dass sich Kunden, Händler und Portalbetreiber ein Bild von den verschiedenen elektronischen Zahlungssystemen machen können. So kann jeder individuell nach seinen Bedürfnissen entscheiden, welches das geeignetste Zahlungssystem für ihn ist.Gang der Untersuchung:Diese Arbeit besteht aus 6 Kapiteln, beginnend mit Kapitel 1, das die Zielsetzung und die Motivation beschreibt. Anschließend erfolgt der Ablauf der Umsetzung. Kapitel 2 erläutert die Grundlagen elektronischer Zahlungssysteme und deren Funktionen. Des Weiteren werden die klassischen Zahlungssysteme, um die es in dieser Arbeit geht, vorgestellt und erklärt.Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Rechtsgrundlagen elektronischer Zahlungssysteme, wobei hier besonderer Wert auf die entsprechenden Datenschutzrichtlinien gelegt wird. Zum Schluss des Kapitels werden die einzelnen elektronischen Zahlungssysteme nach Bereichen aufgeteilt und noch einmal im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen analysiert. Kapitel 4 befasst sich mit der wirtschaftlichen Bedeutung elektronischer Zahlungssysteme für Händler und Kunden. Hierbei werden vor allem die Vor- und Nachteile für Händler und Kunden behandelt.Kapitel 5 betrachtet die Anforderungen an elektronische Zahlungssysteme. Hierfür werden die elektronischen Zahlungssysteme, gegliedert nach Bereichen, in den einzelnen Anforderungen bewertet. Nach der Bewertung erfolgen ein Vergleich aller genannten elektronischen Zahlungssysteme und die Auswertung einer für diese Arbeit angefertigten Umfrage. Kapitel 6 enthält eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIIAbbildungsverzeichnisVIIGlossarVIII1. Einleitung12.Technologie der Zahlungssysteme22.1Verschlüsselungsverfahren22.1.1Symmetrische Verschlüsselungsverfahren32.1.2Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren42.1.3Hybride Verschlüsselungsverfahren52.1.4RSA62.1.4.1RSA- Algorithmus62.1.4.2RSA- Verschlüsselung72.1.4.3RSA- Entschlüsselung82.1.5Public Key Infrastructure - PKI92.1.5.1Zertifizier. 108 pp. Deutsch.
-
Spielzeug zum Bauen und Konstruieren und seine Bedeutung für 6 - 12 jährige Kinder in der Einschätzung sozialpädagogischer Fachkräfte
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687515ISBN 13: 9783838687513
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1992 im Fachbereich Pädagogik - Schulpädagogik, Note: 2,0, Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Sozialpädagogik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Kinder haben bis zu ihrem sechsten Lebensjahr im Durchschnitt schon 15000 Stunden gespielt und werden bis zu ihrem zwölften Lebensjahr weitere 10000 Stunden spielen, haben dann also insgesamt 25000 Stunden (Pee, 1991) gespielt. Daher scheint es wichtig zu sein, sich einmal damit auseinander zu setzen, mit welchen Spielzeugen sich Kinder beschäftigen, was sie mit diesen Spielzeugen anfangen und wie sich diese Spielzeuge auf die Kinder auswirken.In dem Kinderzimmer eines Schulkindes ist eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Spielzeuge zu finden. Zum Teil sind es Spielzeuge, die auch einen Erwachsenen zum Spielen reizen könnten, häufig sind die Spielzeuge aber von abstoßender Hässlichkeit; grelle Farben, hässliche Formen, kitschige Figuren, künstliche Materialien und schlechte Qualität des Spielzeugs lassen beim Erwachsenen schnell die Sehnsucht nach Einfachheit, Schlichtheit, gedeckten Farben und hochwertigen Materialien aufkommen.Es stellt sich die Frage, ob solche Spielzeuge für das Kind sinnvoll sein können.Wird das Kind durch das große Angebot an Formen, Farben, Funktionen und Spielmöglichkeiten eher gefördert oder geschädigt Das Spielen von Kindern in den ersten sechs Jahren und auch das Spielzeug für die Kinder in dieser Altersgruppe wurde in den letzten beiden Jahrzehnten recht genau untersucht und auch in der Fachliteratur dargestellt. Das liegt wohl zum einen daran, dass man in unserer Gesellschaft dieser Lebensphase eine besondere Bedeutung für das ganze weitere Leben zumisst, zum anderen sind zumindest die Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten bei Spielen leichte zu beobachten als ältere Kinder, die zumeist nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen betreut werden.Über das Spielen der Sechs- und Zwölfjährigen und deren Spielzeug wir deutlich weniger in der Literatur berichtet. Da für diese Altersgruppe Spielen und Spielzeug eine große Bedeutung hat, und sich die Erkenntnisse über die jüngeren Kinder auch nicht einfach übertragen lassen, möchte ich mit dieser Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Erkenntnisse auf diesem Gebiet zu erweitern.Diese Arbeit soll eine Spielzeugart behandeln, die für diese Altersgruppe als besonders wichtig erscheint. Spielzeuge zum Bauen und Konstruieren sind für die gesamte Altersgruppe und sowohl für Mädchen als auch für Jungen in gleichem Maße relevant. Außerdem haben viele Erwachsene zu dieser Spielzeugart durch eigenes Spielen als Kind einen starken Bezug, und es geht von ihr wegen der Vielseitigkeit dieser Spielzeugart eine gewisse Faszination aus.Als Informationsquellen diente zum einen die Fachliteratur, zum anderen wurde eine Befragung von Kinder- und Schülerhorten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung12.Spielen und Spielzeug32.1Das Spielen des Kindes32.2Spielzeug für Kinder63.Spielzeug zum Bauen und Konstruieren83.1Begriffsbestimmung und Abgrenzung83.2Das gegenwärtige Angebot an Spielzeugen zum Bauen und Konstruieren103.2.1Fröbel-Baukasten123.2.2Uhl-Baukasten133.2.3Baufix133.2.4Lego143.2.5constri143.2.6fischertechnik1 53.2.7märklin metall173.3Bedeutung der Spielzeuge zum Bauen und Konstruieren für das Kinderspiel183.4Spielzeug zum Bauen und Konstruieren in der Bewertung der Fachliteratur213.5Die Gefährdung der Gesundheit des Kindes233.5.1Unmittelbare Gefährdungen233.5.2Mittelbare Gefährdungen274.Beschreibung der zu untersuchenden Altersgruppe235.Beschreibung der Horte336.Hypothesen zur Spielsituation in Horten357.Befragung zur . 88 pp. Deutsch.
-
Zum Vertrauen rußlanddeutscher Aussiedler in die Duisburger Polizei
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687507ISBN 13: 9783838687506
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Sozialpädagogik / Sozialarbeit, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen (Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Werden in aktuellen Diskussionen die Aussiedler in Deutschland thematisiert, dann dominieren Schlagworte wie Sprachkompetenz und Integration . Diese finden sich regelmäßig in Politikeraussagen und Medienberichten wieder. Dabei wird die Beherrschung der deutschen Sprache als Schlüssel zum Gelingen der Integration hervorgehoben.Beispielhaft hierfür war etwa die Aussage des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen Jochen Welt in einer Pressemitteilung im März 2001. Ohne deutsche Sprachkenntnisse besteht weder gesellschaftlich eine hinreichende Möglichkeit, eingegliedert zu werden, noch haben die Betroffenen eine Chance, einen Arbeitsplatz zu finden (Welt 2001).Der Zuzug von Aussiedlern nach Deutschland an sich ist nichts Neues. Bis Ende der Achtziger Jahre verlief dieser auch ruhig und ohne größere Probleme. Der Großteil reiste seinerzeit aus Polen und Rumänien ein. Das sollte sich mit Ausklang des Jahrzehnts jedoch ändern. Zum einen stieg die Gesamtzahl deutschstämmiger Zuwanderer rapide an. Zum anderen stellten ab 1990 erstmals die Russlanddeutschen den größten Anteil daran. Dieser pendelte sich in den Folgejahren bei Werten von über 90% ein (Holtfreter 1999).Woran lag es nun aber, dass parallel zum Einsetzen dieser Entwicklungen die Integration der Aussiedler schwieriger wurde Hier sind nicht zuletzt die ökonomischen Aspekte zu nennen. So begann der enorme Zuwanderungszuwachs im Zeitraum der deutschen Wiedervereinigung. Wegen der damals angespannten finanziellen Lage waren Haushaltskürzungen in etlichen Bereichen unumgänglich. Davon betroffen zeigte sich auch die Integrationshilfe für Aussiedler (vgl. Sasse 1999: 229). Probleme entstanden zudem bei der Unterbringung der eintreffenden Menschen, womit insbesondere die Städte zu kämpfen hatten. Sie konnten den nötigen Wohnraum nicht direkt zur Verfügung stellen und suchten deshalb Abhilfe in Übergangswohnheimen. Dort lebten die Aussiedler durchschnittlich zunächst rund eineinhalb Jahre (Giest-Warsewa 1998). Während dieser Zeit stellte sich ihr Kontakt zu den Einheimischen meist sehr gering dar und blieb weitestgehend auf die Ämter und die Medien beschränkt.Diese Arbeit konzentriert sich auf die Russlanddeutschen. Sie stellen, wie erwähnt, seit Beginn der neunziger Jahre den Großteil der Aussiedler und fallen zudem durch ihren Gemeinschaftssinn auf. Dieser könnte im Integrationsprozess hilfreich sein und genutzt werden. Allerdings sammeln die Betroffenen nicht selten schon kurz nach der Ankunft Erfahrungen der Isolation sowie der Ablehnung seitens der Einheimischen und der Ausländer. Infolgedessen bildeten und bilden sich besonders in den Großstädten noch immer in einzelnen Stadtteilen oder Straßenzügen eigene Netzwerke und Kolonien . Die hauptsächlichen Kontakte beschränken sich dort auf die eigene Familie und den Freundeskreis; die Umgangssprache ist russisch.Im Integrationsprozess zu erreichende Ziele sind auch das Vertrauen in die hiesige Polizei und deren Inanspruchnahme, damit gegebenenfalls auf diese staatliche Ressource bzw. die bestehenden Rechte zurückgegriffen wird. Hinderlich können sich dabei natürlich auch Sprachschwierigkeiten und der Rückzug in eigene Netzwerke auswirken. Im Rahmen dieser Arbeit sollte aber gerade auf eine weitere Barriere eingegangen werden.So merkte schon Giest-Warsewa (1998) an, dass das traditionelle Misstrauen aus dem Herkunftsland gegenüber staatlichen Institutionen . auch auf die deutsche Polizei übertragen wird. Diese Ansicht wurde in der Forschung zwar vielfach geteilt (Nemigorskij/Gladtschenko 1997, Reich et al. 1999, Schmitt 2000), bislang aber nicht empirisch belegt. Es scheint sich also bisher meist eher. 104 pp. Deutsch.
-
Struktur und Management der nichtöffentlichen Funknetze
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687302ISBN 13: 9783838687308
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Nachrichtentechnik / Kommunikationstechnik, Note: 2,0, Fachhochschule der Deutschen Telekom in Leipzig (Nachrichtentechnik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Das Ziel dieser Diplomarbeit lag in der Beschreibung der verschiedenen mehr oder minder bekannten nichtöffentlichen Funkkommunikationsnetze. Die Arbeit besteht im Bezug auf die Funktechnik aus drei verschiedenen Teilen:Den fachlichen Grundlagen, den nichtöffentlichen Funknetzen und den öffentlichen Funknetzen, wobei das Hauptaugenmerk auf die nichtöffentlichen Funkanwendungen und -netze gerichtet ist.Die Aufgabe der Diplomarbeit bestand darin, den Aufbau und die Funktionsweise verschiedener nichtöffentlicher Funkdienste, -netze und anwendungen, z. B. Betriebsfunk, Bündel und BOS-Funk, zu beschreiben.Als praktische Beispiele wurden in dieser Arbeit u. a. militärische Fernmeldenetze Deutschlands und den USA vorgestellt. Im zivilen Bereich wurde das 1996 neu eingeführte Bündelfunksystem SMARTNET der Motorola GmbH, welches auf dem Flughafen Halle/Leipzig zum Einsatz kommt, ausführlich beschrieben. Hierbei traten anfänglich, verständlicherweise aus Sicherheitsgründen, Probleme bei der Recherche nach Literatur und Informationen auf. Um die Geheimhaltung vieler Funkanwendungen sicherzustellen, mußte bei vielen Systemen auf technische Details verzichtet werden.Unter Betriebsfunkanwendungen sind innerbetriebliche Kommunikationsmöglichkeiten zu verstehen. In diesem Fall wurde ein gegenwärtiges Betriebsfunksystem im Bereich der Eisenbahnen (Deutsche Bahn AG) erläutert. Zur Erleichterung des technischen Verständnisses wurden Skizzen und Blockschaltbilder beigefügt.Im Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wurden funktechnische Grundlagen, der Aufbau der Funknetze und auch die Organisation der Funkanwendungen beschrieben.Weiterhin gibt es neben den nichtöffentlichen Sprechfunksystemen lokale Fernschreibnetze, Satellitennavigationssysteme, Flugfunkanwendungen und Funkdienste in der See- und Schifffahrt. Diese Systeme wurden anhand einiger Beispiele erläutert.Aufgrund der sehr schnell fortschreitenden Entwicklung der Technik, wurde auf eine nähere Beschreibung der Endgeräte (Funkgeräte, Funkstationen etc.) verzichtet.Da sich diese Diplomarbeit hauptsächlich an nachrichtentechnisch versierte Personen richtet, wurden z. B. Einheiten oder Formelzeichen nicht näher erläutert.Mit Hilfe dieser Diplomarbeit soll erreicht werden, Licht in das Dunkel der verschiedensten nichtöffentlichen Funkdienste und netze zu bringen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Abkürzungsverzeichnis11.Einleitung7 2.Fachliche Grundlagen83.Nichtöffentliche Funknetze173.1Betriebsfunk173.1.1Zugfunk183.1.2Neues GSM-R-System223.1.2.1DIBMOF-Pilotstrecke233.1.2.2Unterschiede von GSM-R zu GSM253.1.2.3GSM-R bei europäischen Bahnen263.2Bündelfunk63.2.1Grundlagen263.2.1.1Grundstrukturen von Bündelfunknetzen293.2.1.2Leistungsmerkmale313.2.1.3Verkehrsarten323.2.1.4Unterschiede zum öffentlichen Bündelfunk343.2.2Bündelfunksystem SMARTNET343.2.2.1Einleitung343.2.2.2Systemeigenschaften353.2.2.3Organisa tion der Funkteilnehmer403.2.2.4Konzept des Bündelfunkterminals433.2.3Bündelfunksystem PLUS453.3BOS-Funk463.3.1Grundlagen463.3.1.1BOS-Dienste473.3.1.2Funkkanäle und Frequenzen493.3.1.3Funknetze503.3.1.3.1Dispatchernetz503.3.1.3.2Relaisstell ennetz523.3.1.3.3Gleichwellen- und Gleichkanalfunk563.3.1.3.4Alarmnetz583.3.2Funkfernschreibnetze593.3.2.1Polizei593.3.2 .2Bundesgrenzschutz613.3.2.3Interpol623.3.2.4Deutsches Rotes . 128 pp. Deutsch.
-
"almost customers" als Zielgruppe für das Interessentenmanagement
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687345ISBN 13: 9783838687346
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 2,0, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:In Praxis und Wissenschaft ist es unbestritten, dass die Neukundengewinnung etwa um das vier- bis sechsfache teurer ist als die Bindung aktueller Kunden. Ein bestehender Kundenstamm verringert sich jedoch schon allein aufgrund natürlicher Fluktuation, wie beispielsweise durch einen Umzug oder einer Veränderung der Bedürfnisse der Kunden. Daher sollte die Neukundengewinnung nicht vollständig aus dem Fokus der Unternehmen verschwinden. Sie ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die Zahl der Kunden konstant zu halten oder sogar auszubauen.Gerade weil die Akquisition neuer Kunden sehr kostspielig ist, ist es wichtig, diesen Prozess so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Es sollte eine möglichst große Anzahl der durch Marketingmaßnahmen gewonnenen Interessenten in tatsächliche Kunden verwandelt werden. Jedoch ist es praktisch nicht als realistisch anzusehen, dass alle Interessenten tatsächlich eine Kaufabsicht entwickeln. Daher ist es besonders wichtig, dass diejenigen, die sich zu einem Kauf entschlossen haben auch wirklich kaufen. In der Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass selbst Interessenten mit einer Kaufabsicht sich noch am Point of Sale (POS) des Anbieters umentscheiden und unverrichteter Dinge wieder weggehen. Dieser Sinneswandel kann entweder durch verhaltenswissenschaftliche Gründe (wie etwa der Wahrnehmung bestimmter negativer Dinge) oder durch sonstige Probleme bei der Leistungserstellung zustande kommen. Personen mit einer festen Kaufabsicht, die schließlich doch nicht ausgeführt wird, bezeichnet man als almost customer (AC).Durch diese AC entgehen den Unternehmen hohe Umsätze, die verhältnismäßig einfach in wirkliche Umsätze umgewandelt werden könnten, da der Hauptteil der Kundengewinnung bereits erfolgreich war, es fehlt ja nur an der Ausführung. Aus diesem Grund ist es für die Unternehmen besonders wichtig, Maßnahmen zu implementieren, die dabei helfen, das AC-Phänomen zu bekämpfen.Wenn ein Unternehmen dieses Problem erkannt hat, wird es vor der Frage stehen, in welche Abteilung die Zuständigkeit fällt. Die Verantwortlichkeit bemisst sich häufig danach, in welcher Phase des Kundenlebenszyklus diese eingreifen soll. Nachdem die AC die Kaufhandlung noch nicht wirksam abgeschlossen haben, wären die Aufgaben demnach dem Interessentenmanagement (IM) zuzuordnen, also dem Bereich im Unternehmen, der sich darum kümmert, Interessenten zu gewinnen, bei ihnen eine Kaufabsicht zu entwickeln und sie dadurch zu einer Kaufhandlung zu bewegen. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, herauszuarbeiten, welche Implikationen aus dem AC Problem für das IM folgen.In der Praxis gibt es bisher nur selten ein systematisches IM. Außerdem beginnt das Problem der AC gerade erst beachtet zu werden. Somit besteht hier noch ein erhebliches Optimierungspotenzial. Auf der wissenschaftlichen Seite gibt es diesbezüglich einige erste Ansatzpunkte. Haas und Steimle beschäftigen sich mit dem Thema IM, gehen jedoch nicht näher auf die Möglichkeit ein, dass Interessenten mit Kaufabsicht unter bestimmten Umständen nicht kaufen könnten. Barnes und Leduc beschäftigen sich mit AC, erarbeiten aber keine betrieblichen Handlungsempfehlungen. Daher erscheint es sinnvoll, diese beiden Forschungsgebiete miteinander zu verbinden und eine integrierte Sichtweise einzunehmen. Dafür ist es notwendig, Gründe für dieses Nicht-Kauf-Verhalten herauszuarbeiten um auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse durch das Entwickeln geeigneter Gegenmaßnahmen Hilfestellung für eine Umsetzung in der Praxis leisten zu können.Es ist das Ziel dieser Arbeit, den Versuch einer Typologisierung von A. 108 pp. Deutsch.
-
True Sale Securitization in Germany and China
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687191ISBN 13: 9783838687193
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Master's Thesis from the year 2004 in the subject Business economics - Trade and Distribution, grade: 1,3, University of Frankfurt (Main) (Rechtswissenschaften, Law and Finance), language: English, abstract: Inhaltsangabe:Abstract:The Master thesis for LL.M. at Goethe university s ILF titled True Sale Securitization in Germany and China is a comparative study about true sale securitization. The initial reason for a comparative study was the similarity of banking centred financial systems in these two countries. Another reason is connected with the True Sale Initiative (TSI), a plan composed by major German banks aiming at improving their financial situation. German banks start to be plagued by the non-performing loans (NPLs) since 2001 due to mediocre performance of German corporations and depreciation of banks investment to the east part during 1990s. Facing the competitions from other countries and under pressures from the International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (Basel II) issued by the Basel Committee on Banking and Supervisory Practice (Basel Committee) at the Bank for International Settlements, the German banks employed the TSI as one part of the bigger financial reform to regain competition in Europe and worldwide. December 2004, the first true sale securitization was successfully constructed in Germany after German federal government changed some of its formerly unfriendly legal, taxation and accounting rules. The German experiences with TSI can shed some light into how China to develop its asset-backed securities (ABS) market in order to save its heavy NPLs-burdened banks and find alternative funds for its corporations. Although securitization might be a possible solution, the Chinese current legal system and market infrastructure prevents it from fully utilizing this modern financing technique. What China can learn from Germany s experiences is, that a special securitization law is preferred to amending each relevant laws and rules in order to get rid of legal barriers and contradictions for true sale securitizations. In addition, strong governmental supports will facilitate and accelerate the process of true sale securitization market development. The similarities between the German and Chinese financial system is the main incentive for this study. Both Germany and China have a financial system that is dominated by banks and at the same time features a weak capital market. Banks are the main external financing sources for domestic corporations. Furthermore, in both countries banks are suffering losses and carrying burden of non-performing loans (NPLs), due to the bad performance of domestic corporations (China has been suffering a huge amount of NPLs, whereas Germany just started to have this problem since 2001). Banks in both countries are also facing cutthroat international competition and have motivations to improve their competitiveness.By analyzing the legal obstacles that lie in the true sale securitization transactions in Germany, as well as the pros and cons of its True Sale Initiative plan, I will argue that China is not yet prepared for capital market orientated financial systems like the U.S. and the U.K. There are no developed concepts and legal frameworks for corporate governance, shareholders rights and management fiduciary, and currently banks are still the main external sources for corporate financing. China should learn from Germany s experiences to strengthen its banking sector, since both countries have similar problems in how to improve banks profitability and competitiveness. From Germany s recent experiences in true sale securitization I will shed some light on what China needs to do in order to utilize securitization for Chinese banks. China is under huge pressures to open its financial market to foreign banks, according to China s . 84 pp. Englisch.
-
Das Recht der Kreditsicherheiten in den neuen EU-Staaten
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687418ISBN 13: 9783838687414
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich VWL - Makroökonomie, allgemein, Note: 2,1, AKAD Fachhochschule Stuttgart (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Am 01.05.2004 sind mehrere Staaten Osteuropas der Europäischen Union beigetreten, wodurch damit zu rechnen ist, dass deutsche Unternehmen beispielsweise verstärkt in den beiden neuen EU-Staaten Polen und Tschechische Republik investieren werden. In dem Zusammenhang wurde es für erforderlich gehalten, das Recht der Kreditsicherheiten in diesen Staaten näher zu betrachten.In dieser Arbeit werden daher die verschiedenen Kreditsicherheiten getrennt jeweils nach dem Recht der beiden Staaten beschrieben und für jede einzelne Sicherheit die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Diese Diplomarbeit hat zum Ziel, den Kompetenzträgern in einem Kreditinstitut ein Urteil über polnische und tschechische Kreditsicherheiten zu ermöglichen.Der Aufbau des Kreditsicherheitenrechts in Polen und der Tschechischen Republik ist dem deutschen bzw. österreichischen Recht ähnlich. Es erfolgt eine Unterscheidung in Real- bzw. Sachsicherheiten und Personalsicherheiten. Ferner kann eine Unterteilung nach den Sicherungsobjekten (bewegliche / unbewegliche Sachen, Forderungen) getroffen werden.Bei den Personalsicherheiten ist z.B. die Bankgarantie nach polnischem und tschechischem Recht annähernd gleich. Als ein Unterschied wurde beispielsweise festgestellt, dass dem Bürgen nach tschechischem Recht keine Einreden zustehen aber nach polnischem Recht sogar Einreden, auf welche der Schuldner verzichtet hatte.Die Sachsicherheiten sind vielfältiger als die Personalsicherheiten, weshalb neben den eher grundsätzlichen Gemeinsamkeiten wie etwa die Nicht-Akzessorietät der Sicherungsübereignung auch mehr Unterschiede aufgezeigt werden konnten. Beispielhaft ist aufzuführen, dass bei der Bestellung einer Hypothek im tschechischen Recht Grundstücke und Gebäude sowie Zubehör als rechtlich selbständige Sachen betrachtet werden. Dagegen bildet in Polen ein Grundstücke samt Bestandteilen (u.a. Gebäude [mit Ausnahmen]) und Zubehör ein Belastungsobjekt. Die Hypothek nach polnischem Recht unterscheidet sich ferner von ihrem tschechischem Pendant dadurch, dass sie auch am Erbnießbrauch (einschließlich der Gebäude des Erbnießbrauchers) und an einer hypothekarisch gesicherten Forderung bestellt werden kann.Die rechtliche Ausgestaltung entsprechender Sicherheitenverträge wird, abgesehen vom Verständnis der tschechischen und polnischen Sprache, im Grunde als weniger problematisch beurteilt. Als problematisch stellt sich die Werthaltigkeit einer vertraglich einwandfrei vereinbarten Kreditsicherheit sowohl in Polen als auch in der Tschechischen Republik dar. So wird etwa die Werthaltigkeit des tschechischen Pfandrechtes vor allem durch das gesetzliche Steuerpfandrecht und teils ungeklärte Eigentumsverhältnisse bei Immobilien negativ beeinflusst. Überdies schlägt bei Sicherungsübereignungen und Abtretungen der mit Eigentumsübergängen verbundene Steueraufwand zu Buche. Für polnische Kreditsicherheiten ist zum Teil Ähnliches festzustellen. Doch hier sind bereits Entwicklungen zur Beschränkung der Vorherrschaft des Steuerrechts feststellbar. Dies ist an der Einführung des Registerpfandrechts und dem Wegfall der gesetzlichen Hypothek ersichtlich. Schließlich wurde in der Literatur aber keine Auseinandersetzung mit einer Kollision von Pfandrecht und Abtretung bei Forderungen weder nach tschechischem noch nach polnischem Recht gefunden.Allgemein wird im Rahmen der Rechtsangleichung zwischen den Staaten der Europäischen Union künftig mit der Abnahme der aufgezeigten Unterschiede gerechnet. Bisherige Erfahrungen zeigen jedoch, dass in der Regel viel Zeit bis zur Umsetzung in nationales Recht vergangen ist.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AB. 76 pp. Deutsch.
-
Reliabilität und Validität der Messung von beruflichem Status
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687817ISBN 13: 9783838687810
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:In dieser Arbeit wird der zur Reliabilitätsbestimmung erforderliche Vergleich zweier Messungen anhand des multiplen Messformats verfolgt. Dabei werden die Messformate anhand innerhalb Deutschlands gängiger Skalen zur Messung des Berufes operationalisiert. Die Beurteilung der Messkriterien Validität und Reliabilität erfolgt dabei anhand von Strukturgleichungsmodellen. Diese ermöglichten es, explizite Annahmen über die Messung des sozio-ökonomischen Status zu formulieren.Die Modelle basieren auf dem sehr gut untersuchten Statuserwerbsmodell von Blau & Duncan (1967), dass auch auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angewendet wurde. Die im Pfadmodell formulierten Kausalbeziehungen können als weitestgehend bestätigt gelten. Dies ermöglicht die Messformate hinsichtlich der erwarteten Zusammenhänge auf Messgenauigkeit und Gültigkeit zu untersuchen.In einem weiteren Schritt wurde die Veränderung der Zusammenhänge untersucht, den die Schätzung des beruflichen Status mit Hilfe multipler Indikatoren bewirkt. Somit war es möglich festzustellen, ob das Modell über eine höhere Erklärungskraft im multiplen Fall verfügt, oder ob eine Schätzung auf Basis eines Messindikators ausreichend ist. Zusätzlich wurde untersucht, ob Effekte aufgrund von Geschlecht und Alter des Befragten die Zusammenhänge innerhalb der Strukturgleichungsmodelle beeinflussen.Die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit waren demnach:Wie hoch ist die Qualität der Indikatoren für den beruflichen Status insgesamt Wie reliabel und valide sind die Messformate, wenn man sie miteinander vergleicht Ist es sinnvoll den beruflichen Status anhand mehrerer Indikatoren zu bestimmen Die vorliegende Arbeit ist in fünf Teile gegliedert. Das zweite Kapitel befasst sich mit den messtheoretischen Grundlagen, die für diese Arbeit benötigt werden. Es wird zunächst bestimmt was unter dem Vorgang des Messens verstanden werden soll. Des weiteren werden Kriterien vorgestellt mit deren Hilfe beurteilt werden kann, wie gut ein Messinstrument ein bestimmtes Phänomen misst. Es handelt sich dabei um die Gütekriterien Reliabilität und Validität. Neben der theoretischen Darstellung der Kriterien werden verschiedene Methoden zur empirischen Bestimmung der Kriterien besprochen.Das Konzept des sozio-ökonomischen Status soll in dieser Arbeit anhand zweier Indikatoren gemessen werden. Um eine Vorstellung zu bekommen, was genau gemessen werden soll, widmet sich das [¿] 160 pp. Deutsch.
-
Betriebssport als Instrument zur Förderung einer teamorientierten Unternehmenskultur
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838648110ISBN 13: 9783838648118
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Magisterarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Sport - Sportökonomie, Sportmanagement, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Dieses Zitat des erfolgreichen amerikanischen Unternehmers Lee Iacocca reduziert die komplexen Vorgänge in Unternehmen auf drei essentielle Aspekte: Menschen, Produkte und Profit. Er verdeutlicht, dass diese Faktoren interdependent sind und effektive Teamarbeit ausschlaggebend für erfolgreiche Produkte sowie dem daraus resultierenden Profit ist. Die Menschen im Unternehmen wurden nunmehr nicht nur als homos oeconomicus gesehen, sondern als entscheidender Erfolgsfaktor im Unternehmen. Während in der Vergangenheit mehr Wert auf die harten Faktoren des Unternehmens gelegt wurde, stieg in den 90er Jahren die Bedeutung der weichen Faktoren signifikant an. In einer Zeit zunehmender Umweltkomplexität und dynamik stehen die Menschen immer häufiger im Mittelpunkt unternehmerischer Überlegungen.Nicht mehr nur die Produkte und der damit verbundene Profit stehen im Mittelpunkt, sondern die Mitarbeiter selbst. Der Erfolg und das Wachstum der Unternehmung hängen neben der Qualität seiner Produkte immer häufiger maßgeblich von der Leistungsfähigkeit, der Leistungsbereitschaft und den Kompetenzen der Mitarbeiter sowie effektiver Teamarbeit ab. Wettbewerbsvorteile, die in Produktinnovationen liegen, überleben in der heutigen Zeit bei weitem nicht mehr so lange wie noch vor zwei Jahrzehnten. Dies gilt aber nicht für Faktoren wie Motivation, Wissen, Kreativität, Innovationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen diese sind langlebig. Genau an diesen Punkten wirkt die Unternehmenskultur. Sie schafft Sinnzusammenhänge für Mitarbeiter und trägt zu deren Identifikation mit dem Unternehmen bei.Die Definitionsansätze des Begriffes Unternehmenskultur in der Literatur sind vielfältig. Jedoch stimmen die diversen Definitionen und Ansätze überein mit der Vorstellung von einem Unternehmen als kulturelle Einheit mit unverkennbarer Identität. Um die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern und zu steigern, ist es heutzutage notwendig, die Wertschöpfungskette ganzheitlich und unter Berücksichtigung unternehmenskultureller Aspekte zu betrachten. Neben der ökonomischen Orientierung muss auch eine soziale Ausrichtung im Unternehmen zu finden sein. Man sollte ein Unternehmen nicht mehr nur als Produktionsstätte für Güter und Dienstleistungen sehen, das eine Gewinnmaximierung anstrebt, sondern als Erfahrungsplatz und Verwirklichungsfeld für Menschen insbesondere in der Konstellation des Teams.In der neueren Literatur zur Personalwirtschaft begegnet man zunehmend den Begriffen Human Ressource Management , fraktales Unternehmen und Total Quality Management . Diese unterschiedlichen Konzepte haben eines gemeinsam den Ansatzpunkt Mensch als strategischen Erfolgsfaktor. Der Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens und demzufolge seine Unternehmenskultur hängen maßgeblich von der Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und den Kompetenzen seiner Mitarbeiter ab. Agieren diese lediglich isoliert als Einzelkämpfer im Unternehmen und kooperieren nicht untereinander, lässt sich nicht das gesamte Potenzial der Mitarbeiter nutzen.Effektive Teamarbeit unter den Mitarbeitern ist notwendig, um dieses Potenzial effizient nutzen zu können und Synergieeffekte zu entwickeln. Man benötigt ein gutes Team, um produktiv und profitabel zu sein. Die Teammitglieder fungieren als essentielle Determinante im Unternehmen und sollen im Rahmen einer teamorientierten Unternehmenskultur zu Mit-Wissern, Mit-Arbeitern und Mit-Erfolghabern werden. Gelingt dies, identifizieren sich die Teammitglieder mit ihrem Unternehmen und sind demzufolge intensiv an die Ziele des Unternehmens gebunden. Sie agieren eigenständig bei der Entwicklung . 124 pp. Deutsch.
-
Definitionen, Statistiken, Aspekte und der Versuch einer psychologischen Aufarbeitung der Behindertenproblematiken in Deutschland zur Harmonisierung der Gesellschaft
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687531ISBN 13: 9783838687537
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Psychologie - Arbeit, Betrieb, Organisation und Wirtschaft, Institut für berufliche Weiterbildung Lörrach (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Angeborene oder durch Unfall verursachte Behinderungen/Schwerbehinderungen sind im derzeitigen Deutschland seltener, sondern hier entwickeln sich die meisten gesundheitlichen Störungen über Jahre und Jahrzehnte in der Folge oder Sequenz `Krankheit-Behinderung-Schwerbehinderung .So sind die Hälfte der 8000000 registrierten (hohe Dunkelziffer) Schwerbehinderten in Deutschland über 65 Jahre alt und gesundheitsunabhängig i.A. altersberentet, zunehmend weniger als 1000000 Schwerbehinderte arbeiten (meist in Behindertenwerkstätten mit durchschnittlichen Einkommen bei Vollzeitarbeit i.H.v. Euro 65.- im Monat und Sozialhilfe) und zunehmend mehr als 3000000 Schwerbehinderte sind mit höchst fraglichen Einkommen langzeitarbeitslos, denn rein technisch müssen auch sie einmal gearbeitet haben, weil alle Menschen in Deutschland schulisch, zu 40% akademisch und allermeist auch weiterführend beruflich ausgebildet sind.Relativ leicht Behinderte und alle Kranke sind in Deutschland nicht registriert und statistisch beim Statistischen Bundesamt nicht erfasst.Da in Deutschland mittlerweile nur noch 24000000 Menschen täglich mittels bezahlter Arbeit ihre Existenz sichern, also 29% der Gesamtbevölkerung, ist möglich, dass 71% krank/ behindert/ schwerbehindert sind.Dieses Ergebnis ähnelt dem Ergebnis einer FOCUS-Studie aus dem Jahr 2000, wonach in Deutschland 64000000 Menschen, also 77%, nicht ohne Medikamente leben können.Über die aktuellen typischen allgemeinen und hauptsächlichen Lebensprobleme und Lebensumstände von diesen möglicherweise 77% Kranken/ Behinderten/ Schwerbehinderten in einem Staat wie Deutschland ist bisher noch nicht viel zusammengefasst worden, und insofern bemüht sich diese Arbeit nun darum, damit man sich ein besseres und aktuelles Bild vom Leben mit Handycap in Deutschland machen und über Verbesserungen zielorientiert, demokratisch, realistisch und menschengerecht diskutieren kann.Diese Arbeit basiert auf den in der Materialsammlung (III) und den in den Literaturangaben (VIII) zusammengestellten Recherchen, wobei von da keine speziellen Zitate und Texte verwendet, sondern journalistisch frei Inhalte sinngemäß wiedergegeben oder eigene Erhebungen (z.B. VI B) dargestellt wurden, weswegen in dieser Arbeit, wie sonst in wissenschaftlichen Arbeiten üblich, keine speziellen Literaturhinweise an den entsprechenden Stellen im Text vermerkt sind.Insofern wurde sich an die vom Prüfungsausschuss des IBW bestimmte, wissenschaftlich nicht spezifizierte, freie Form gehalten.Zusammenfassung:Diese Arbeit beschreibt die aktuellen Behindertenproblematiken etwa seit 2000 in Deutschland.Inzwischen sind neue Behindertengesetze in Kraft getreten, haben Wirtschaftsdepressionen mit Massenentlassungen besonders Kranker/ Behinderter/ Schwerbehinderter stattgefunden, sind zunehmend Kranke/ Behinderte/ Schwerbehinderte nicht zu ihren Rechten gekommen und hat jüngst der Gesundheits- und Sozialabbau in Deutschland begonnen.Anlässlich der Erhebungen darüber, wie viele Menschen in Deutschland zum Arzt gehen und Medikamente einnehmen müssen, und anlässlich der Tatsache, dass diese Kranken/ Behinderten/ Schwerbehinderten ähnliche gesetzliche Ansprüche haben, war es für diese Arbeit notwendig, Kranke/ Behinderte/ Schwerbehinderte zu einer Gruppe mit gleichen Interessen und gleichen, nur mehr oder weniger stark ausgeprägten Problemen zusammenzufassen, zumal es auch in menschlichen Lebensverläufen i.A. so ist, dass sich aus Krankheiten Behinderungen und Schwerbehinderungen entwickeln, und zumal schon zu Anfang dieser meisten gesundheitlichen Verlaufssequenz selbe psychologische Belastungen. 48 pp. Deutsch.
-
Restauratio und Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 383868723XISBN 13: 9783838687230
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Inhaltsangabe:Einleitung:Die Kapitel 24 27 des Jesajabuches auch Jesaja-Apokalypse genannt gehören zu jenen Texten des Alten Testaments, welche die Gelehrten besonders viel Tinte kosteten. Weshalb also noch eine weitere Arbeit über dieses Stück hinzufügen Der bis heute bestehende Dissensus bezüglich mehrerer Fragen zur Jesaja-Apokalypse unter den Forschern zeigt, dass weiterhin ein Bedarf an Klärung vorliegt. Unsere Arbeit möchte ein weiterer Beitrag zu einer Lösung sein.Den Anlass für diese Arbeit gab eine nähere Beschäftigung mit der Frage der Auferstehung im Alten Testament und die damit verbundene Feststellung, dass die Interpretation von Jes. 26:19 in diesem Zusammenhang besonders umstritten ist. Während ein Grossteil der Gelehrten der Meinung ist, mit der Wiederbelebung in Jes. 26:19 sei leibliche Auferstehung gemeint ja es handle sich hier um den ersten klaren Hinweis auf eine leibliche Auferstehung im Alten Testament überhaupt deuten zahlreiche andere Wissenschaftler die Stelle metaphorisch auf die nationale Wiederherstellung Israels und einige wenige auf die geistige Wiedergeburt. Welche dieser drei Deutungen ist richtig Kann man die Frage überhaupt mit (letzter) Gewissheit beantworten Soviel ist klar: losgelöst vom Kontext, nur für sich genommen, kann der Vers à la limite tatsächlich jede der genannten Bedeutungen haben. Wenn überhaupt, dann ist eine Entscheidung zwischen den verschiedenen Vorschlägen nur im Lichte des Kontexts möglich. Damit verbunden ist (bzw. wird) aber nicht zuletzt auch die Frage der Genesis der Jesaja-Apokalypse: Bilden die vier Kapitel eine ursprüngliche Einheit oder sind sie das Resultat eines (mitunter langen) Wachstumsprozesses Ist die so genannte Jesaja-Apokalypse ein buntes Patchwork, bestehend aus mehreren ursprünglich unabhängigen Perikopen, die bei der Zusammensetzung durch einen so genannten Redaktor oder Kompilator, je nachdem, vielleicht mitunter noch zum Zweck der Anpassung an den neuen Kontext umgeschrieben oder ergänzt wurden und wenn ja, ist zudem vielleicht noch an weitere noch spätere Glossen wenn vielleicht auch nur von wenigen einzelnen Versen oder Versteilen zu denken, oder bildete die ganze Apokalypse von Anfang an eine wesentliche Einheit, in welche aber später vielleicht doch noch die eine oder andere Passage (z. B. 24:21-23 oder 25:10b-12) oder vereinzelte Verse (z. B. 26:19) oder vielleicht auch nur das eine oder andere Sätzchen (z. B. 25:8a) oder mitunter sogar nur [¿] 340 pp. Deutsch.
-
Excavation Scheme for a Deep Wagon Tippler at Jawaharlal Nehru Port Trust, Bombay
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687566ISBN 13: 9783838687568
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Scholarly Research Paper from the year 2000 in the subject Engineering - Civil Engineering, grade: 1,3, Hamburg University of Technology (Bauingenieurwesen und Umwelttechnik), language: English, abstract: Inhaltsangabe:Introduction:The Jawaharlal Nehru Port Trust, called JNPT, is situated close to Mumbai (former name Bombay) at the same channel used by Mumbai Port and Jawahar Dweep Oil Terminal. It is the youngest and most modern port of India. Commissioned in May 1989, the port still has high development ambitions especially in the sector of expansion, which is necessary in view of its purpose of decongesting Mumbai Port and the serving as a Hub Port for this region. The new Nhava Sheva Container Terminal Project is an example for the continuous progress in realising these plans.In carrying out of these plans, structures like deep wagon tippler are required for managing bulk cargoes at the bulk terminals. This type of structure allows an economical unloading of cargoes from trains. Because of the necessary depth of a wagon tippler the cargoes have to surmount a difference in altitude of about 12 m from ground level and additional the difference in altitude from ground level up to the vessel. This can only be done by using long conveyor tunnels. An elevation of the cross section for a typical deep wagon tippler, borrowed from an existing structure.In the first part of this project work, a review on different, often used schemes, for deep excavations is done to find out a favourable excavation scheme for construction of a deep wagon tippler. The choice for a structure using RCC diaphragm walls as retaining walls is based on its merits under the existing soil conditions and on a possible serving as part of the final structure. During a site visit to JNPT the decision for this type of excavation scheme was discussed with site engineers, who have experience in constructing RCC diaphragm walls under existing soil and groundwater conditions.Finally an analysis of a typical cross section of the deep wagon tippler has been carried out by using the structural engineering software STAAD III, based on the Finite Element Method. The safety of the structure against failure caused on external and internal loads is proofed as well as for the case of an earthquake, which will be very possible, because of the location of the site in the earthquake zone four.SUMMARY:The aim of this project work was to work out an excavation scheme for the construction of a deep wagon tippler at JNPT Mumbai under actual loading condition. For solving this problem, first a comparison of different schemes for deep excavations was done. The final choice of using diaphragm walls supported by a deck slab as excavation scheme was based on its economical and structural merits compared with other types. During the site visit at JNPT a professional construction of a diaphragm wall could be studied. Discussions with site engineers were helpful to decide for this type of structure.To find out a safety and economical structure, analyses for different types of diaphragm walls were done. In five steps the first structure, diaphragm walls with rectangular cross section and height of 25.6 m, connected with a deck slab, was modified to reach an optimal result in consideration of economical and static aspects. The choice of T-sections for the walls to take the large bending moments based on earth pressure, water pressure, dead load, live load and additional loads for earthquake case, turned out to be better than a rectangular section. It was possible to reduce the high deflection values of the walls. Comparing the T-sections with a thickness of 2.5m and 3.0m it was favourable to choose the light weightier structure.A lighter structure will give a higher stability in case of earthquakes, so deflection values were almost the same. The saving of material and working time will help to make the structur. 128 pp. Englisch.
-
Basel II
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687256ISBN 13: 9783838687254
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Hochschule Bremen (Nautik und Internationale Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Seit Veröffentlichung der ersten Baseler Eigenkapitalvorschläge 1999 ist das Stichwort Basel II in der Wirtschaftspresse ein Dauerbrenner. Auch die Nachrichten zum Thema Rating im Zusammenhang mit Basel II, verbreiteten sich nicht nur im Finanzsektor, sondern vor allem unter den Unternehmen wie ein Lauffeuer. Informationsveranstaltungen, -broschüren, Zeitungsartikel, Zeitschriftenbeiträge usw., die sich mit der Erneuerung befassen, nahmen deutlich zu.Der Grund dafür, dass diese Thematik so große Aufmerksamkeit genießt, sind die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht vorgeschlagenen und im Juni 2004 verabschiedeten Modifikationen der Eigenkapitalstandards. Jedes Kreditinstitut muss bei der Vergabe eines Kredites einen bestimmten Betrag an Eigenkapital unterlegen bzw. bereithalten (Eigenkapitalunterlegung), damit bei Kreditausfällen ihre Existenz nicht gefährdet ist. Während zur Zeit jede Bank pauschal 8% des jeweiligen Kreditvolumens als Eigenkapital zu unterlegen hat, müssen Kreditinstitute nach der neuen Regelung für risikobehaftetere Firmenkredite mehr Eigenkapital vorhalten als für risikoärmere. Dabei wird, und das ist das neuartige daran, das Rating eines Kreditnehmers zukünftig das wesentliche Kriterium zur Bestimmung seiner Bonität und damit zur Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung der Kreditinstitute sein. Die Folge ist, dass zukünftig die anhand des Ratings ermittelte Bonität des Unternehmens maßgeblich für die Kreditvergabe und insbesondere für die Zinskonditionen sein wird.Auf Grund der Tatsache, dass die Fremdfinanzierung durch Bankkredite gerade für mittelständische Unternehmen die zentrale Form der Mittelbeschaffung darstellt, müssen sich diese unbedingt mit dem Thema Rating und den damit verbundenen Anforderungen der Banken auseinandersetzen. Schließlich wird das Ergebnis des Ratings für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Existenz bestimmend sein, denn die Banken werden gezwungen sein, Geschäftsverbindungen zu Kreditnehmern mit einem schlechten Rating zu beenden, um hohe Ausfallwahrscheinlichkeiten und damit Kreditrisiken zu vermeiden, sog. Portfolio-Steuerung.Oft wissen die Unternehmen jedoch nicht oder nur ungenau, was eine Bank für Ihr Rating braucht, obwohl aus einer Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Banken, Einsichten resultieren können, die eine Verbesserung der Ratingeinschätzung zu Folge haben könnten. Die Erfüllung der Raitinganforderungen stellt für kleine und mittlere Unternehmen auf der einen Seite ein mögliches Problem dar, auf der anderen Seite bietet es Chancen für die weitere Unternehmensentwicklung.Ziel dieser Diplomarbeit ist es daher einen Überblick über die Ratinganforderungen der Banken an ihre Kunden (hier speziell an KMU) zu geben. Ferner sollen die sich aus den Ratinganforderungen der Banken ergebenden Auswirkungen für KMU beurteilt werden.Gang der Untersuchung:Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst (Kapitel zwei) die begriffliche Grundlegung geschaffen. Dabei werden der für die Arbeit relevante Bereich des deutschen Mittelstandes anhand von qualitativen und quantitativen Merkmalen abgegrenzt und seine Bedeutung und derzeitige Finanzierungssituation erläutert. Darauf folgt eine Definition und Abgrenzung des Begriffes Bank sowie die Erläuterung des deutschen Geschäftsbankensystems. Mit einer Übersicht über Basel II wird der Hintergrund für den eigentlichen Schwerpunkt der Arbeit, nämlich dem Rating und spezieller den Anforderungen des bankinternen Ratings, gezeichnet.Die Bonitätseinschätzung erfolgt nach Basel II entweder anhand externer Ratingnoten oder mit Hilfe bankinterner Ratingverfahren. Kapitel drei widmet sich dem Thema Rating, erlä. 124 pp. Deutsch.
-
Co-Communication
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687736ISBN 13: 9783838687735
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,5, European Business School - Internationale Universität Schloß Reichartshausen Oestrich-Winkel (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Zahlreiche Entwicklungen im Werbeumfeld der Unternehmen haben dazu geführt, dass Co-Communication sich wachsender Beliebtheit erfreut. Schrumpfende Marketing-Budgets, die Schwierigkeit, sich in übersättigten Märkten Gehöhr zu verschaffen sowie die Erosion traditioneller Zielgruppendefinitionen erklären das Bestreben vieler Werbetreibende, sich zum Zwecke der Marktkommunikation zusammenzuschließen. Die Kooperation kann hierbei diverse Formen annehmen, die eines gemeinsam haben: Eingesetzt wird Co-Communication deshalb, weil durch den gemeinschaftlichen Auftritt mehrerer Marken das Ausschöpfen von Synergiepotenzialen möglich wird. Diese Synergien äußern sich in den langfristigen, außerökonomischen Wirkungen der Co-Communication, den Carry-Over-Effekten. Hierbei besteht die Besonderheit, dass diese durch Wechselwirkungen zwischen den Marken zustande kommen. Gerade vor dem Hintergrund der Komplexität, die der Umsetzung von Co-Communication innewohnt, ist es essentiell, die Frage nach Effizienz und Effektivität der eingesetzten Mittel zu beantworten. Denn wie gut die Co-Communication funktioniert, hängt letztendlich von den erzielten Wirkungen ab. Diese mit den Instrumenten der Werbewirkungsforschung zu erfassen ist Gegenstand dieser Arbeit. Denn wenngleich Co-Communication sich zu einem in Praxis und Forschung zunehmend diskutierten Thema entwickelt hat, steckt ihre Wirkungsforschung noch in den Kinderschuhen. Um eine professionelle Herangehensweise in Zukunft zu gewährleisten, ist Klarheit darüber notwendig, welche Verfahren sich zur Erfassung gegenseitiger Carry-Over-Effekte eignen. Nur so kann Unternehmen ein Handlungsrahmen geboten werden, der es ermöglicht, Co-Communication als Bestandteil durchdachter und wirkungsvoller Kommunikationsstrategien zu etablieren.Problemstellung:Es ist Aufgabe dieser Arbeit, gängige Verfahren der Werbewirkungsforschung auf ihre Tauglichkeit für die Erfassung von Carry-Over-Effekten zu überprüfen. Stützen soll sich diese Aufgabenstellung in der Tat auf das Gebiet der Werbung. Dies liegt darin begründet, dass die theoretischen Erkenntnisse in diesem Bereich bereits ausgereift sind, und sich eine Vielzahl valider Modelle zur Erklärung der Wirkungen bewährt hat.Zum anderen sind Methoden der Werbewirkungsforschung auf den gesamten Bereich der Kommunikation übertragbar. Es soll dargestellt werden, was diese Verfahren im Falle der Co-Communication leisten können und wo ihre Grenzen liegen. Damit einher geht die Berücksichtigung der besonderen Anforderungen, die Carry-Over-Effekte als zusätzliche Dimension bei der Erfassung stellen. Ziel dieser Arbeit ist es folglich, als Ergebnis dieser Aufgabenstellung einen geeigneten Handlungsrahmen für Wirkungsmessung von Co-Communication zu entwickeln: Wie können Unternehmen, die sich an kooperativen Formen der Marktkommunikation beteiligen, die damit verbundenen gegenseitigen Wirkungen erfassen, und welche Grenzen haben diese Verfahren Dies soll im gleichen Zuge zu der Antwort auf die Frage führen, inwieweit konventionelle Messmethoden der Werbewirkungsforschung auf diese besondere Fragestellung angewendet werden können, und welchen Aspekten im Rahmen der Erfassung gegenseitiger Carry-Over-Effekte besondere Beachtung geschenkt werden sollte. Die gewonnen Erkenntnisse sollen Unternehmen, die an Co-Communication teilnehmen, konkrete Möglichkeiten aufzeigen, die Veränderungen im Markenprofil der beteiligten Partner zu erfassen und die Wirksamkeit ihrer Kommunikationszusammenschlüsse in einem systematischen Prozess zu überprüfen.Gang der. 116 pp. Deutsch.
-
Neuere Bestrebungen zur Reform der Wertermittlung für Zwecke der Erbschaftsbesteuerung unter Berücksichtigung der Verfassungsmäßigkeit
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687450ISBN 13: 9783838687452
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,3, Fachhochschule Mainz (III / Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Die Erbschaft- und Schenkungsteuer stellt - wenn auch meist als Randgebiet verkannt - eine nicht zu verachtende Komponente dar. So wird die Nachkriegs- und Wirtschaftswundergeneration, die nicht nur gearbeitet, sondern auch gespart hat, bei ihrem Tode eine nicht unbeträchtliche Summe an Vermögen ihren Erben hinterlassen. In diesem Jahrzehnt werden ca. 2 Billionen Euro von einer Generation an die nächste vererbt. [.] Knapp vierzig Prozent der Haushalte hinterlassen Summen von 25 000 bis 150 000 Euro. [.] Sieben Prozent der Haushalte vererben mehr als 150 000 Euro. Etwa die Hälfte des Erbes besteht in der Regel aus Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Grund genug, die im Zusammenhang mit der Erbschaftsteuer bestehenden verfassungs-rechtlichen Bedenken, in Bezug auf die Wertermittlung, näher zu durchleuchten. Wiederholt werden Fragen aufgeworfen, ob und inwieweit einzelne Erbschaftsteuervorschriften die Grenzen der Verfassungswidrigkeit überschritten haben. Gegenstand der Arbeit sollen dabei konkret die 12 und 13 bzw. 13a ErbStG sowie die im Zusammenhang damit einschlägigen Paragraphen des Bewertungsgesetzes sein. Andere Kritikansätze neben der Verfassungswidrigkeit sollen dagegen nicht Grundlage der Arbeit sein. Ausgangspunkt für die Betrachtungen wird dabei der Beschluss des BVerfG vom 22.06.1995 und die zu diesem Zeitpunkt geltende Wertermittlung sein. Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei große Abschnitte. Der erste, Kapitel 2 und 3, befasst sich mit der bis Ende 1995 maßgebenden Wertermittlung und den, durch den BVerfG-Beschluss vom 22.06.1995 herausgearbeiteten, verfassungsrechtlichen Bedenken. Hierdurch zum Handeln gezwungen, verabschiedete der Gesetzgeber das Jahressteuergesetz 1997. Daher wird im zweiten Abschnitt, Kapitel 4 und 5, die mit diesem Gesetz einhergehende aktuelle Wertermittlung erläutert und sodann untersucht, ob die verfassungswidrigen Feststellungen seitens des BVerfG ausgeräumt wurden. Ferner wird in diesem Abschnitt auf diverse Beschlüsse des BFH eingegangen, in denen dieser erneut verfassungsrechtliche Zweifel an der durch das JStG 1997 normierten Wertermittlung äußert .Durch die Beschlüsse des BFH einerseits bzw. durch die i.R.d. Wertermittlung anstehenden Neubewertungen 2006 andererseits, ist der Gesetzgeber erneut zum Handeln gezwungen. So wird letztlich im dritten Abschnitt, Kapitel 6 und 7, die zukünftige Wertermittlung beschrieben und analysiert, die auf einem aktuellen Gesetzesentwurf Schleswig-Holsteins zur Reform der Erbschaftsbesteuerung basiert. Aufgrund des limitierten Rahmens kann hier nur auf wesentliche Punkte eingegangen werden. Keine nähere Berücksichtigung finden, weil im Zusammenhang mit der Verfassungsmäßigkeit unrelevant, daher die 10 und 11 ErbStG. Auch auf die Wertermittlung bzgl. des Erbbaurechts, bzgl. der Gebäude auf fremdem Grund und Boden bzw. der Gebäude im Zustand der Bebauung wird nicht näher eingegangen. Gleichfalls nicht erörtert wird die Problematik der Bewertung im Zusammenhang mit den Vermögensgegenstände in den neuen Bundesländern. Außer Acht gelassen werden auch Kriterien in Bezug auf den Grundbesitz, die sich aufgrund besonderer baulicher Ausgestaltungen oder aufgrund spezieller landwirtschaftlicher Nutzungen ergeben.Anzumerken ist ferner, dass Änderungen, wie sie durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/ 2002 bzw. durch das Steueränderungsgesetz 2001 entstanden, im Hinblick auf die Wertermittlung und die damit zusammenhängende Verfassungsmäßigkeit unerheblich sind und demzufolge einbezogen wurden. Hingegen werden die Anpassungen an den Euro - normiert durch das Euroglättungsgesetz 2000 - ab Kapitel 4 mit eingearbei. 72 pp. Deutsch.
-
Trinkwasserversorgung im internationalen Vergleich
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687590ISBN 13: 9783838687599
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich VWL - Sonstiges, Note: 1,3, Technische Universität Hamburg-Harburg (Wasserressourcen und Wasserversorgung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Im internationalen Vergleich gibt es große Unterschiede in der Gestaltung der Trinkwasserversorgung. Unterschiedliche politische, wirtschaftliche, naturräumliche und soziokulturelle Rahmenbedingungen verlangen nach angepassten Strukturen. Vielfach jedoch werden die vorhanden Strukturen und Systeme den komplexen Anforderungen einer nachhaltigen Trinkwasserversorgung nicht gerecht. Einerseits sollen Reformen im öffentlichen Wassersektor helfen, diese Situation zu verbessern, darüber hinaus gibt es aber auch Bestrebungen, verstärkt privatwirtschaftliche Unternehmen an Aufgaben der Wasserversorgung zu beteiligen.In industrialisierten Ländern ist eine Versorgung mit Trinkwasser in aller Regel sichergestellt. Auch wenn es zum Teil Reformbedarf bei den Strukturen sowie Sanierungsbedarf bei den Versorgungssystemen gibt, ist die Grundversorgung mit Trinkwasser in den allermeisten Ländern nicht gefährdet. Reformansätze zielen hier in erster Linie auf eine Effizienzsteigerung bei den Versorgungsunternehmen sowie auf die Entlastung der öffentlichen Haushalte durch Kosteneinsparungen. Vielfach wird hierzu auch eine Liberalisierung der Wasserversorgung gefordert. In Schwellen- und Entwicklungsländern stellt sich die Situation oft weitaus schwieriger dar. Rasant steigende Bevölkerungszahlen sowie schwierige Rahmenbedingungen führen dazu, dass eine flächendeckende Versorgung von ausreichender Qualität nicht für alle Bevölkerungsschichten erreicht werden kann. Oft fehlen finanzielle Möglichkeiten, um dringend erforderliche Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. Eine Lösung hierfür wird daher häufig auch in Entwicklungsländern in der Übertragung von Versorgungsaufgaben an private Betreiber gesucht.Angesichts des vielerorts großen Reformbedarfs in der Wasserwirtschaft ist es hilfreich, den Blick auf verschiedene Situationen und Strukturen weltweit zu richten, diese zu bewerten und aus negativen wie positiven Erfahrungen bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen, der Versorgungsunternehmen und der Versorgungssysteme Alternativen für reformbedürftige Wasserwirtschaften aufzuzeigen. In der vorliegenden Arbeit werden hierfür wesentliche Aspekte der Trinkwasserversorgung im internationalen Zusammenhang untersucht. Dabei richtet sich der Blick zunächst auf die Versorgungssituation und auf die Qualität der Versorgung. Weiterhin werden allgemeine Rahmenbedingungen für wasserwirtschaftliche Strukturen erörtert, anschließend die unterschiedlichen Strukturen selbst untersucht und bewertet. Abschließend werden auch die weltweit existierenden Trinkwasserpreise und Tarifstrukturen untersucht. Diese sind vor allem für den Verbraucher, neben der Versorgungssicherheit, wichtige Indikatoren für eine funktionierende Wasserwirtschaft.Zusammenfassung:Die weltweite Untersuchung der Trinkwasserversorgung zeigt auf, dass es zum Teil erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Versorgungssituation (Qualität und Quantität), wasserwirtschaftlichen Strukturen sowie Trinkwasserpreisen gibt. Ein detaillierter und objektiver Vergleich der Trinkwasserversorgung der einzelnen Ländern ist jedoch nur schwer zu führen. Der BGW fordert ein Ranking der Trinkwasserversorgung anhand verschiedener Kriterien wie Einhaltung internationaler Qualitätsstandards, Grad der Versorgungssicherheit, Bewertung der durch Trinkwasser übertragenen Krankheiten und Wasserverbrauch. Für eine Bewertung anhand dieser Kriterien bedarf es vor allem vollständiger, aktueller und richtiger Daten aus den einzelnen Ländern, zudem ist eine ausreichende Kenntnis der Situation in den jeweiligen Ländern erforderlich. Ein ausführlicher und belastbarer Vergleich ist daher in erster Linie auf internationaler Ebene z. 156 pp. Deutsch.
-
Der Businessplan als Entscheidungsgrundlage für Kapitalgeber
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838683080ISBN 13: 9783838683089
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensgründung, Start-ups, Businesspläne, Note: 2,0, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Wirtschaftswissenschaften I - Fachbereich 3, Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Ein guter Businessplan beeindruckt durch Klarheit und ( ) Sachlichkeit . Diese in vielen Businessplanwettbewerb-Handbüchern oft wiedergegebene Weisheit als Merkmal erfolgreicher Businesspläne soll nicht angezweifelt werden. Allerdings gilt diese Erkenntnis salopp formuliert analog ebenso für die Gebrauchsanleitungen technischer Küchengeräte. Was also genau sind die entscheidungsrelevanten Merkmale erfolgreicher Businesspläne aus Sicht der Kapitalgeber Und gelten diese Merkmale für eine Bank in gleichem Maße wie für eine Venture Capital Gesellschaft oder eine Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Diese Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Der theoretische Teil beschäftigt sich dabei mit der Analyse und Abhandlung der vorherrschenden Literatur, Fachbeiträgen und wissenschaftlichen Studien zum Thema der kapitalgeberspezifischen Erstellung von Businessplänen, im empirischen Teil werden die Ergebnisse des Fragebogens anhand von geeigneten statistischen Testverfahren auf kapitalgeberspezifische Besonderheiten untersucht und interpretiert.Insgesamt konnten auf Grundlage eines Online-Fragebogens (weiterhin einsehbar unter wwwgreaneyde/Studie/fragebogenhtml) von rund 200 angeschriebenen, in Deutschland ansässigen Kapitalgebern insgesamt 60 für die Teilnahme an der Erhebung gewonnen werden, davon 30 Venture Capital Gesellschaften, 12 Kreditinstitute, 6 Business Angels, 9 MBGen sowie 3 Teilnehmer aus dem Bereich der öffentlichen Förderbanken. Das Ziel dieser Arbeit ist es, auf Grundlage der empirischen Ergebnisse herauszufinden, welche kapitalgeberspezifischen Unterschiede bei den einzelnen Anforderungspunkten eines Businessplans festzustellen sind und ob diese Unterschiede auch unter dem Gesichtspunkt neuer Finanzierungstendenzen eine praktische Relevanz mit sich bringen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIIAbbildungsverz eichnisIXTabellenverzeichnisXIAbkürzungsverzeichnisXV1.Einle itung11.1Problemstellung11.2Aufbau der Arbeit21.2.1Theoretischer Teil21.2.2Empirischer Teil21.3Ziel dieser Arbeit22.Definition und begriffliche Abgrenzung32.1Der Businessplan32.2Arten von Kapitalgebern42.2.1Kreditinstitute42.2.2Banken mit Sonderaufgaben52.2.3Business Angels62.2.4Venture Capital Gesellschaften (VCG)72.2.5Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MBG)82.3Die Prinzipal-Agenten-Theorie93.Theoretische Ansätze der Entscheidungsfindung bei Businessplänen123.1Gründe für die Erstellung eines Businessplans123.2Elementare Bestandteile eines Businessplans133.2.1Executive Summary143.2.2Das Unternehmen153.2.3Management163.2.4Produkte und Dienstleistungen173.2.5Markt und Wettbewerb183.2.6Produktion und F&E203.2.7Planungsrechnung213.3(K)eine Hilfe durch Businessplansoftware233.4Spezifische Stellenwerte eines Businessplans253.4.1Aus Sicht der Agency-Theorie253.4.2Unternehmensintern313.4.3Unternehmensextern333.4.4Im Lichte neuer Finanzierungstendenzen343.5Generelle Adressaten des Businessplans und deren Unterschiede393.5.1Spezifische Anforderungen der untersuchten Kapitalgeber413.5.1.1Kreditinstitute413.5.1.2Förderbanken433.5.1.3Business Angels443.5.1.4Venture Capital Gesellschaften473.5.1.5Mittelständische Beteiligungsgesellschaften503.5.1.6Abschließende Matrix523.6Ziele und Grenzen eines Businessplans544.Empirische Evaluation: Die Entscheidungsfind. 136 pp. Deutsch.
-
Empirik, Notwendigkeiten und Ziele der kooperativen und konstruktiven Konfliktlösung durch Mediation in Deutschland
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687523ISBN 13: 9783838687520
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Institut für berufliche Weiterbildung Lörrach (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Anhand einiger Beispiele bezüglich der Notwendigkeiten individuell angepasster Modernisierungen und persönlichkeitsorientierter Zielsetzungen zur menschen- und lebensfreundlichen Harmonisierung der zersplitterten und zerstrittenen BRD-Gesellschaften wird aufgezeigt, dass traditionelle Methoden im Umgang mit Menschen gescheitert sind und nun kooperative und konstruktive Konfliktlösungen für eine zukunftstragende Gesellschaft im Rahmen von Menschen-, Behinderten-, Frauen- und Seniorenrechten, im Rahmen von intelligenten, modernen, demokratischen, gesundheitsschonenden und sozialen Lebensbedingungen und positiven Lebensqualitäten, und im Rahmen von menschen- und lebensfreundlicher Europäisierung und Globalisierung notwendig geworden sind und zur besseren Zufriedenheit von den betroffenen Bürgern/innen in lebenserfahrenen Eigeninitiativen und mit positiven Visionen nun selber erarbeitet und umgesetzt werden müssen, statt wie bisher alles an den Staat und an Dritte auf die traditionelle Art mit dem Ziel zu delegieren, Sieger und Verlierer zu schaffen und so nur die aggressions- und hassgeschürte und sich problemorientiert weiter massiv befeindende Gesellschaft tief zu spalten bzw. in Parallelgesellschaften zu zersplittern und somit jegliches Miteinander samt konstruktiv lösungsorentierter Dialoge, Konsense und Solidaritäten mit den fatalen Folgen des endgültigen Niedergangs der BRD in allen Bereichen und auf allen Ebenen samt apokalyptisch-niveauloser Verwahrlosung zum auf der Weltrangliste mit anderen Staaten nicht mehr konkurrenzfähigen 3.-Welt-Staat vorsätzlich zu verhindern.Die BRD-Realität ist, dass im gigantischen Paragraphen- und Verwaltungsdschungel nichts und niemand anlässlich von 1,4 Billiarden Euro Staatsschulden mehr gefördert wird, sondern dass es nahezu wieder 80% Immer-ärmer-und-kränker-werdende wie zu unmittelbaren Vorkriegszeiten gibt, dass zunehmende Massenarbeitslosigkeit herrscht, dass sich profitbesessene Unternehmen auf dem Weltmarkt neu orientieren, und dass die Menschen-, Behinderten-, Frauen- und Seniorenrechte samt Antidiskriminierungsgesetze nicht flächendeckend und problemlos umgesetzt werden, sondern ganz im Gegenteil werden die mehrheitlichen Kleinen und Schwächeren der Gesellschaft mit der fatalen Folge kriminalisiert, meist schwer - oft lebenslang - bestraft und ausrangiert, dass sämtliches Vertrauen verloren gegangen ist und es kaum noch Chancen auf das gegen alle Tatsachen von Politikern immer noch versprochene individuelle Wohlergehen bis ins hohe Metusalem -Alter gibt und immer mehr in Depressionen verfallen, so dass in Gesamtbetrachtung der BRD-Standort in allen Bereichen niedergeht und viele Werte-, Niveau-, Freiheits- und Friedliebende fluchtartig das Land verlassen, zumal ursprüngliche BRD-Bürger/innen, die sich nicht bedingungslos an das dekadente System angepasst haben, staatlich nicht respektiert und durch zwischenzeitlich etablierte Ausländer verdrängt werden.Dass nun Betroffene selber kooperative und konstruktive Konfliktlösungen erarbeiten und ihre Streitigkeiten selber mit dem Ziel der größtmöglichen Verträglichkeit in der Zukunft regeln wollen, stellt einen Paradigmen- und Gesinnungswechsel im Selbstwert- und Wertebewusstsein der Menschen, Gesellschaften und Staaten dar, zumal damit eine zunehmende Individualisierung, Demokratisierung und Modernisierung der mehrheitlichen Bevölkerung einhergeht und staatliche Hindernisse der individuell-positiven Persönlichkeitsentwicklungen abgebaut werden müssen, was derzeit aber noch mit der zunehmenden Misstrauensstruktur anlässlich der vollkommenen Transparenz des/der Bürgers/in ( Kriminalisierung der Bevölkerung mit dem aussch. 72 pp. Deutsch.
-
Age Power 2010 - Erfolgreiches Best Ager-Marketing
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687248ISBN 13: 9783838687247
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,3, Hochschule Pforzheim (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Hintergrund meiner Diplomarbeit ist die aktuelle Situation in Deutschland und Westeuropa. Gekennzeichnet ist diese durch existenzbedrohende Preiskämpfe auf überwiegend gesättigten Märkten. Einhergehend ist diese mit einer stärkeren Segmentierung der Märkte durch zunehmende Individualisierung der neuen Konsumenten. Die stagnierende Homogenität der Produkte und der Mangel an echten, für den Konsumenten relevanten Produktinnovationen, fordert eine neue Ausrichtung der Kommunikation. Es gilt für Unternehmer und Werbefachleute sich dieser Herausforderung zu stellen.Gerichtet ist diese Arbeit an alle Unternehmen die vor diesem Hintergrund bestehen wollen. Sie soll dem Leser helfen die Zeichen der Zeit zu erkennen und sein Unternehmen an den gegebenen Umständen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ihm werden Überlegungen nahe gelegt, die aus der Beobachtung der wirtschaftlichen Realität geboren sind. So ist die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft schon lange bekannt. Doch nur zögerlich wird darauf reagiert. Schon vor über zehn Jahren wurde der Seniorenmarkt als Wachstumsmarkt erkannt. Auch ist das Thema gesättigter Märkte kein neues. Meine Muse ist der Mangel , so hat es der Schriftsteller und Buchautor Martin Walser einmal treffend formuliert. Auch ich sehe immer noch einen gewissen Mangel in der Kommunikation und Unternehmensausrichtung hinsichtlich dieser genannten Tatsachen.Diese Diplomarbeit ist aber auch an alle Werbeagenturen gerichtet, die sich ihrer entscheidenden Kommunikationsaufgabe bewusst sein dürften. Viel zu oft kommt der angestrebte Konsens zwischen Unternehmen und Agentur nicht zu Stande. So ist es, nach meiner Auffassung, für den Kreativen in der Agentur genauso wichtig, betriebswirtschaftliches und strategisches Grundverständnis zu schulen, wie es für den Unternehmer wichtig ist, eine richtige Vorstellung von Kommunikation und Kreativität zu besitzen. Denn wer nicht kommuniziert, existiert nicht! Es geht also um die Existenz. Grundsätzliches Ziel der Diplomarbeit ist es einen möglichst umfangreichen Überblick zu geben und dabei die nötige Tiefe nicht zu vernachlässigen. Weiteres Ziel ist es neue Aspekte und neue relevante Sichtweisen in die aktuelle Thematik zu bringen und auf bisherige wichtige Erkenntnisse einzugehen. Dabei wird immer vom Allgemeinen auf das Besondere, sprich den Best Ager, geschlossen. Bewusst wird dabei in wissenschaftlichen Bereichen gesucht, die nur auf den zweiten Blick äußerst ertragreich für das Marketing sind. Im ersten Teil meiner Diplomarbeit wird auf die betriebswirtschaftliche Bedeutung des Best Age-Marktes und die strategische Unternehmensausrichtung eingegangen. Zielsetzung des strategischen Teils ist es, sich bereits vor dem Eintritt in den Best Age-Markt einige grundsätzliche strategische Überlegungen bewusst zu machen. Dabei gilt es, erkennbare Entwicklungen der nächsten Jahre mit einer neuen Strategieempfehlung zu begegnen, welche sich an die zwei wesentlichen Marktteilnehmer richtet, und diese zeitnah umzusetzen. Der Best Age-Markt soll durchaus kritisch hinterleuchtet werden und ein vorausschauendes Profil des Best Agers erstellt werden, das eine Gültigkeitsberechtigung bis 2010 hat. Außerdem wird der Frage nach der Segmentierung des Marktes mit einem neuen Segmentierungsansatz begegnet werden, der nicht Anspruch auf Vollständigkeit, sondern Anspruch auf Gültigkeit stellt und in seinem Wesenskern auf das Wesentliche selbst abzielt. Im zweiten Teil der Arbeit soll eine psychologische Hinführung an den Konsumenten erfolgen. Es geht also um die Psyche des Menschen. Was bestimmt sein Handeln Und was bedeutet das für die Werbung Dies zu bean. 148 pp. Deutsch.
-
Die Unternehmensbesteuerung in Frankreich unter besonderer Berücksichtigung der Steuerreform 2005
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687825ISBN 13: 9783838687827
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Seit Anfang der 1990er Jahre besteht ein europaweiter Trend, körperschaftsteuerliche Anrechnungssysteme durch so genannte Shareholder-Relief-Verfahren zu ersetzen. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist das Bestreben, die jeweilige Unternehmensbesteuerung den Anforderungen des europäischen Rechts anzupassen. Zu Beginn des Jahres 2005 wurde auch in Frankreich im Rahmen einer grundlegenden Reform der Besteuerung von Kapitalgesellschaften und ihrer Anteilseigner ein solches Verfahren eingeführt.Eine Änderung des Körperschaftsteuersystems kann je nach Ausgestaltung tiefgreifende Konsequenzen für die binnenwirtschaftliche und internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen haben. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, die reformierte französische Unternehmensbesteuerung zu beurteilen. Als Maßstab lassen sich einerseits zeitlose Kriterien wie Steuergerechtigkeit, ökonomische Effizienz sowie Praktikabilität und Transparenz heranziehen. Andererseits ist zu prüfen, inwieweit die französische Unternehmensbesteuerung nach ihrer Reform europarechtlichen Vorgaben Rechnung trägt.Für die Untersuchung wurde ein Aufbau in fünf Kapiteln gewählt. Einleitend wird ein Überblick wesentlicher Elemente der Unternehmensbesteuerung in Frankreich gegeben (Kapitel 2). Daran anknüpfend folgt ein kurzer Rückblick auf das frühere Anrechnungsverfahren und dessen Probleme, um anschließend die Reformziele der Regierung und das Anfang 2005 in Kraft getretene Körperschaftsteuersystem vorzustellen (Kapitel 3). Im Hauptteil der Arbeit stehen die Auswirkungen des reformierten Unternehmenssteuerrechts auf grundlegende unternehmerische Entscheidungen zur Diskussion (Kapitel 4). Dabei wird die Rechtsformwahl, die Finanzierungsentscheidung sowie das Investitionsverhalten betrachtet. Darauf folgt eine europarechtliche Konformitätsprüfung der aktuellen Unternehmensbesteuerung (Kapitel 5). Die Abhandlung schließt mit einer bewertenden Zusammenfassung sowie mit einem Ausblick (Kapitel 6).Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisIIITabellenverzeichnisIVAbkürzungsverzeichnisVSy mbolverzeichnisVI1.Problemstellung12.Überblick der Unternehmensbesteuerung22.1Einführung22.2Einkunftsermittlung bei Personengesellschaften72.3Einkunftsermittlung bei Kapitalgesellschaften93.Körperschaftsteuerlicher Systemwechsel123.1Rückblick auf das frühere Anrechnungsverfahren und dessen Probleme123.2Das Körperschaftsteuersystem nach der Steuerreform 2005144.Einfluss des reformierten Steuerrechts auf unternehmerische Entscheidungen164.1Einführung164.2Wahl der Rechtsform164.2.1Steuerliche Bedeutung der Rechtsform164.2.2Einperiodische Betrachtung174.2.3Mehrperiodische Betrachtung214.2.4Weitere steuerliche Einflussfaktoren234.3Wahl der Finanzierungsform264.3.1Steuerliche Bedeutung der Finanzierungsentscheidung264.3.2Finanzierungsentscheidung der Personengesellschaften274.3.3Finanzierungsentscheidung der Kapitalgesellschaften294.3.4Beurteilung und Vergleich mit dem Anrechnungsverfahren324.4Investitionsverhalten364.4.1Steuerliche Bedeutung für die Investitionsentscheidung364.4.2Einfluss der französischen Unternehmensbesteuerung auf die Standortwahl385.Europarechtliche Beurteilung des reformierten Steuerrechts425.1Bedeutung des Europarechts425.2Europarechtlich fragwürdige Regelungen des Unternehmenssteuerrechts436.Schlussbetrachtung456.1Fazit456.2Ausblick48AnhangVIILiteraturverzeichnisVIII 76 pp. Deutsch.
-
Die Standortsuche von Banken im internationalen Blickwinkel unter besonderer Betrachtung von Irland
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687396ISBN 13: 9783838687391
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Wirtschaftswissenschaften I), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Zur Thematik der Standortsuche lässt sich auf eine weitreichende Anzahl von wissenschaftlichen Abhandlungen zurückblicken, die sich seit der wegweisenden Arbeit Johann Heinrich von Thünens Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie aus dem Jahr 1826 mit dieser Materie beschäftigt haben. Diese andauernde akademische Auseinandersetzung spricht für die Relevanz und für die fort-währende Aktualität der vorliegenden Themenstellung. Grundlegend war die Erkenntnis, dass jedes soziale Geschehen und jede wirtschaftliche Tätigkeit neben der zeitlichen auch über eine räumliche Dimension - die Frage des Ortes - verfügt. Die richtige Wahl des Standorts als Grundlage wirtschaftlichen Erfolges ist eine elementare Feststellung. Die Arbeit befasst sich im Kern mit Fragen der unternehmerischen Standortwahl, überträgt diese Problematik auf den Bankensektor und zeigt die praktische Umsetzung anhand von Finanzinstituten am Standort Irland. Am Rande werden die staatliche Standortpolitik sowie die Akquisition von Banken als Sonderform der Standortwahl berücksichtigt.Das der Einleitung folgende zweite Kapitel beginnt mit einem Abriss der historischen Entwicklung von Veröffentlichungen zum Thema Standortsuche. Im Folgenden werden die Standortfaktoren als Entscheidungskriterien herausgestellt und anhand der Einteilung von Karl Christian Behrens Werk Allgemeine Standortbestimmungslehre von 1961 beschrieben. Danach stellt die vorliegende Arbeit das Wachstum und die Rationalisierung als generelle Zielsetzungen der Standortpolitik dar, nach welchen auch später im praxisbezogenen Teil unterschieden wird. Das zweite Kapitel endet mit den Ent-scheidungsverfahren der Standortwahl und den Besonderheiten im Zusammenhang mit dem internationalen Standortmanagement.Im dritten Kapitel folgt die Betrachtung der Standortsuche bei Banken. Die Kreditinstitute begannen weltweit Anfang der 60er Jahre, einige Zeit nach der Industrie, mit einer intensiven Auslandsexpansion. Seitdem ist der Aufbau umfassender internationaler Stützpunktnetze durch den Bankensektor sprunghaft angestiegen und hat ein beachtliches Ausmaß erreicht. Während beispielsweise die deutschen Banken 1963 nur drei ausländische Filialen hatten, verfügten sie Ende 2003 über 322 Filialen und 414 Tochtergesellschaften im Ausland. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich hauptsächlich den für Banken entscheidenden Standortfaktoren und den mit der Standortwahl verfolgten Zielen. Dabei werden die Unterschiede der wichtigsten Präsenzformen aufgezeigt. Weiterhin werden Möglichkeiten bezüglich des bankspezifischen Leistungsspektrums herausgearbeitet.Das vierte Kapitel dieser Arbeit beschreibt zunächst die wirtschaftliche Entwicklung Irlands in den letzten Jahren. Zu Irland äußerte sich der Literatur-Nobelpreisträger George Bernard Shaw einmal in den 1930ern, dass er hoffen würde, an dem Tag auf der irischen Insel zu sein, an dem die Welt endet, da die Iren schon immer 50 Jahre hinter der Zeit gewesen seien. Über 70 Jahre später kann das nicht mehr behauptet werden. Mit einer Wirtschaft, die in den letzten Jahren konstant über dem Durchschnitt der Europäischen Union anwuchs, ist aus Irland ein Standort erster Wahl für multinationale Unternehmen geworden.Das Land hat sich in den letzten Jahren stark verändert, so dass viel über das Wirtschaftswunder des Celtic Tiger diskutiert wurde. Im vierten Kapitel werden die Gründe der Entwicklung untersucht. Im Anschluss erfolgt eine Ergänzung der theoretischen Darstellungen dieser Arbeit durch praktische Erkenntnisse, die hauptsächlich auf einer vom Autor durchgeführten Befragung basieren. So kann die in der Praxis anget. 132 pp. Deutsch.
-
Die Bilanzierung von Leasingverhältnissen im internationalen Vergleich
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687558ISBN 13: 9783838687551
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Das Bestreben der Unternehmen nicht nur auf nationalen Märkten, sondern auch auf internationalen Märkten zu agieren, führt zu einem wachsenden Kapitalbedarf. Dieser steigende Kapitalbedarf soll u. a. durch die Erschließung internationaler Kapitalmärkte gedeckt werden. Damit Kapitalanleger Jahresabschlüsse von nationalen als auch von internationalen Unternehmen vergleichen können, besteht die Notwendigkeit, die Rechnungslegung zu harmonisieren. Mit Verabschiedung der EU-Verordnung 1606/2002 haben alle kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften ihren Konzernabschluss nach IAS/IFRS aufzustellen. Für den Einzelabschluss von kapitalmarktorientierten und nicht kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften besteht für Offenlegungszwecke ein IAS/IFRS-Wahlrecht. Die Pflicht zur Aufstellung eines HGB-Abschlusses bleibt davon unberührt. Die IAS/IFRS gewinnen somit national immer mehr an Bedeutung.Diese Arbeit befasst sich mit der Leasingbilanzierung im internationalen Vergleich. Das Instrument Leasing weist seit Jahrzehnten ein mehr oder weniger stetiges Wachstum auf. Es ist für die unterschiedlichsten Gegenstände möglich und ist in viele Sektoren mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Unternehmenspolitik geworden. Die Gründe für Leasing sind vielfältig. Dazu zählen beispielsweise steuerliche Vorteile, flexibel gestaltbare Leasingvereinbarungen, Schonung des Kreditrahmens, und der Verschuldungsgrad wird i. d. R. nicht belastet. Dabei kann beim Leasing die reine Nutzungsmöglichkeit des Leasinggutes oder die Finanzierungsalternative zum Kauf im Vordergrund stehen. Hierbei können Probleme in Bezug auf die bilanzielle Behandlung dieser Verträge auftreten. Die Leasingbilanzierung gehört mit zu den am meisten diskutierten Problemen der Rechnungslegung. Die folgende Arbeit soll aufzeigen, wie diese Probleme nach Handelsrecht und nach IAS/IFRS behandelt werden, um anschließend kritisch festzustellen, ob die jeweils gewählten Ansätze dafür geeignet sind.Gang der Untersuchung:Neben der Problemstellung, dem Aufbau der Arbeit wird die Zielsetzung der Arbeit im Gliederungspunkt 1 erörtert. Gliederungspunkt 2 befasst sich mit den Grundlagen nationaler und internationaler Rechnungslegung. Anschließend werden im Gliederungspunkt 3 der Begriff Leasing, die Erscheinungsformen und die Abgrenzung zu anderen Verträgen erläutert. Der Gliederungspunkt 4 beschäftigt sich mit der Behandlung von Leasingverhältnissen nach Handelsrecht und IAS/IFRS. Die Bilanzierung von Leasingobjekten im Jahresabschluss nach Handelsrecht und IAS/IFRS wird im Gliederungspunkt 5 dargestellt. Eine umfangreiche kritische Würdigung erfolgt im 6. Gliederungspunkt. Neuvorschläge bei der Behandlung von Leasingverhältnissen sollen im 7. Gliederungspunkt ansatzweise aufgezeigt werden. Mit Gliederungspunkt 8, der eine Schlussbemerkung enthält, schließt diese Arbeit ab.Schwerpunktmäßig werden Mobilienleasingverhältnisse von Kapitalgesellschaften betrachtet. Nicht behandelt werden Sale-and-lease-back, die Behandlung von Leasing im Konzernabschluss, Herstellerleasing und Immobilienleasing.Mit dieser Arbeit soll geprüft werden, inwieweit es einen Unterschied in der Beurteilung und in der Bilanzierung von Leasingverträgen nach HGB und IAS/IFRS gibt. Die daraus resultierenden Ergebnisse, werden daraufhin untersucht, ob sie zweckkonform sind, ob eines der beiden Rechnungslegungssysteme besser zur Leasingklassifizierung geeignet ist und ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbkürzungsverzeichnisIV1. Einleitung11.1Problemstellung11.2Aufbau der Arbeit21.3Zielsetzung32.Grundlagen nationaler und i. 100 pp. Deutsch.
-
Die handels- und steuerrechtlichen Neuerungen für den Jahresabschluss 2004
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 383868771XISBN 13: 9783838687711
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,7, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Allein durch die Verpflichtung der Unternehmen, einen Jahresabschluss aufzustellen (242 Abs. 1 HGB), ist nicht sichergestellt, dass die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung eingehalten werden und den Bilanzadressaten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird. Durch mehrere Bilanzskandale wie die von Flowtex, EM-TV und Comroad ist das Vertrauen in die Aktienmärkte und die Abschlussprüfung stark gesunken. Um dieses Vertrauen wiederherzustellen, hat die Bundesregierung am 25. Februar 2003 einen Maßnahmenkatalog zum 10-Punkte-Programm zur Stärkung der Unternehmensintegrität und des Anlegerschutzes vorgestellt, der durch verschiedene Gesetze umgesetzt werden soll. Für die Rechnungslegung ergeben sich durch das Bilanzrechtsreform- und Bilanzkontrollgesetz5 sowie durch das für das 1. Halbjahr 2005 angekündigte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz entscheidende Neuerungen. Ebenso sind auch viele wichtige steuerliche Neuerungen durch Steuergesetzesänderungen, die Rechtsprechung und umfangreiche Verwaltungsanweisungen hervorgegangen. Für die Unternehmen stellt es eine Herausforderung dar, jederzeit über die aktuellen Regelungen informiert zu sein und vor allem auch diese in die betriebliche Praxis umzusetzen.Die folgende Diplomarbeit gibt einen systematischen Überblick über die handels- und steuerrechtlichen Neuerungen zum Jahresabschluss 2004. Sie hilft den Unternehmen durch den Gesetzesdschungel zu finden und zu erkennen, durch welche Regelungen das jeweilige Unternehmen konkret betroffen ist. Es wird erläutert, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die neuen Regelungen zu erfüllen. Dem Rechnungswesen der Unternehmen wird ein Leitfaden zur Hand gegeben, der die Aufstellung des Jahresabschlusses 2004 erleichtert.Die Arbeit beginnt mit den handelsrechtlichen Neuerungen, da diese unmittelbar in den Jahresabschluss einfließen . Zuerst werden die beiden verabschiedeten Gesetze zum Bilanzrecht vorgestellt, wobei das Bilanzrechtsreformgesetz für die betriebliche Praxis die größere Bedeutung hat. Das Bilanzkontrollgesetz richtet sich ausschließlich an kapitalmarktorientierte Unternehmen. Danach wird darauf eingegangen, welche Neuerungen durch das Gesetzesvorhaben zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Unternehmen zukommen können.Im weiteren Verlauf der Arbeit werden im Kapitel 3 die wichtigsten steuerlichen Neuerungen aus der Gesetzgebung, Rechtsprechung und den Verwaltungsanweisungen dargestellt. Über die Maßgeblichkeit nach 5 Abs. 1 EStG sind die handelsrechtlichen Regelungen auch bei der steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Da viele Unternehmen keine eigenständige Steuerbilanz erstellen, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass die steuerlichen Regelungen auch in die Handelsbilanz einfließen . Nach einem kurzen Überblick über die aktuellen Steuergesetzesänderungen und die Steuersätze werden zuerst die bilanzsteuerlichen Neuerungen in der Reihenfolge der Bilanzgliederung nach 266 HGB dargestellt. In jedem Unterkapitel wird der aktuelle Bezug genannt, so dass dem Leser sofort ersichtlich wird, durch welches Steuergesetz, Urteil oder welche Verwaltungsanweisung sich die jeweilige Neuerung ergeben hat.Aufbauend auf den beiden vorhergehenden Kapiteln werden dann im Kapitel 4 Gestaltungsempfehlungen erarbeitet, durch deren Anwendung die betriebliche Steuerlast minimiert werden kann.Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse in thesenhafter Form (Kapitel 5).Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:ABBILDUNGSVERZEICHNISVII1.PROBLEMSTELLUNG UND. 84 pp. Deutsch.
-
Übernahmen insolventer Unternehmen
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838649109ISBN 13: 9783838649108
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,7, European Business School - Internationale Universität Schloß Reichartshausen Oestrich-Winkel (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Insolvenzen und Übernahmen sind alltägliche Ereignisse in einer Marktwirtschaft. Der Erfolg eines Unternehmens, welches in einem Markt agiert, ist kein Dauerzustand, sondern muss ständig erarbeitet werden. Arbeitet ein Unternehmen nicht effizient, so wird es durch den Markt sanktioniert. Die langfristige Konsequenz für ein ineffizientes Unternehmen ist das Ausscheiden aus dem Markt, beispielsweise durch eine Insolvenz oder eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen. Somit stellen diese beiden Ereignisse Konsequenzen der Selbststeuerungskraft des Marktes dar, welche zum Erhalt und zur Effizienz einer funktionstüchtigen Marktwirtschaft beitragen.Die Bedeutung von Insolvenzen und Übernahmen hat in den letzten Jahren in den meisten marktwirtschaftlich organisierten Ländern zugenommen. Darüber hinaus lässt sich eine zunehmende Verknüpfung der beiden Ereignisse beobachten. Dieser Trend, der vor allem in den USA erkennbar ist, ist durch empirische Studien belegbar. Die Verknüpfung von Übernahmen und Insolvenzen eröffnet ein neues wissenschaftliches Themengebiet, aus dem die vorliegende Arbeit einige ausgewählte Fragestellungen analysiert.Werden Übernahmen und Insolvenzen miteinander kombiniert, stellt sich zunächst das Problem, wann eine Verknüpfung der beiden Ereignisse aus Sicht der Marktteilnehmer sinnvoll ist. Präzise formuliert stellt sich die Frage, unter welchen Umständen es aus Sicht des Verkäufers und des Käufers rational ist, ein insolventes Unternehmen zu verkaufen bzw. zu kaufen. Die Beantwortung dieser Fragestellung ist das erste Ziel dieser Arbeit. Allerdings beschränkt sich die Arbeit aufgrund des limitierten Betrachtungsumfangs auf die Analyse aus Verkäufersicht.Sowohl Insolvenzen als auch Übernahmen bzw. Verkäufe von Unternehmen werden im allgemeinen entsprechend bestimmter Prozesse abgewickelt. Diese Prozesse können verschiedene Formen annehmen. Der Insolvenzprozess ist hierbei von besonderer Bedeutung, da er sowohl in Form eines gesetzlichen bzw. formellen Verfahrens als auch in Form eines informellen Verfahrens durchgeführt werden kann. Bei der Verbindung von Übernahmen und Insolvenzen ergibt sich demnach die Frage, inwieweit sich die zwei vormals separaten Prozesse gegenseitig beeinflussen. Das zweite Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Interdependenz der beiden Prozesse zu analysieren.Ein zentraler Bereich des Themengebietes der Übernahmen ist die Unternehmensbewertung. Werden Übernahmen und Insolvenzen miteinander kombiniert, so muss dieser Bereich auf Insolvenzen übertragen und angewendet werden. Diese Anwendung der Unternehmensbewertung auf insolvente Unternehmen ist deshalb das dritte Ziel dieser Arbeit. Konkreter formuliert zeigt die Arbeit, welche Modelle der Unternehmensbewertung für die Bewertung insolventer Unternehmen geeignet bzw. ungeeignet sind. Darüber hinaus wird erörtert, inwieweit die Aussagekraft der Bewertungsmodelle für insolvente Unternehmen eingeschränkt ist, da zusätzlichen Faktoren einen Einfluss auf den Wert eines insolventen Unternehmens nehmen.Investoren bzw. Käufer von Unternehmen stellen einen weiteren wesentlichen Aspekt des Themengebietes der Übernahmen dar. Neben unterschiedlichen Akquisitionsarten stehen hinter Übernahmen auch verschiedene Motive von Investoren. Bei Übernahmen insolventer Unternehmen stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit dieser Aspekte auf insolvente Unternehmen. Daher ist die vierte Zielsetzung dieser Arbeit, Investoren bzw. Käufer insolventer Unternehmen zu charakterisieren und deren Motive für die Übernahme eines insolventen Unternehmens zu. 96 pp. Deutsch.
-
Financial Planning
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687809ISBN 13: 9783838687803
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Fachhochschule Kaiserslautern (Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Ziel der Arbeit war es, einen Überblick über die Beratungsdienstleistung Financial Planning im gehobenen Privatkundensegment zu schaffen. Zunächst wurde der Begriff des Private Banking näher betrachtet, seine verschiedenen Ausprägungen näher erläutert und als Betreuungs- und Servicekonzept für die jeweilige Top-Klientel eines Anbieters positioniert. Die Dienstleistung Financial-Planning , welche lange Zeit nur als Praktiker-Disziplin am Markt ohne entsprechende Fundierung etabliert war, konnte anschließend unter verschiedenen Definitionsansätzen näher beleuchtet und verglichen werden. Financial Planning ist zentraler Baustein eines ganzheitlichen, strategischen Kundenbindungsmanagements und kann seine herausragende Rolle im Private Banking nur dann entfalten, wenn nicht ein enger, produktorientierter Ansatz, sondern eine kundenorientierte, bedürfnisgetriebene Betreuungsphilosophie verfolgt wird.Nach einer Abgrenzung zu anderen Geschäftsfeldern und Beschreibung des Ursprungs dieser Dienstleistung wurden unterschiedliche Definitionen der Zielkundensegmente verglichen. Eine eindeutige Definition der Zielgruppe anhand quantitativer Kriterien konnte nicht festgestellt werden, sodass der Finanzplaner seine Kunden anhand allgemeiner Eigenschaften definiert. Eine Marktpotenzialanalyse konnte den vorhandenen Markt bestätigen.Ausgehend von einer globalen Betrachtung mit Daten des World Wealth Reports kann den deutschen Bundesbürgern anhand statistischer Rechnungen der Bundesbank trotz des schwierigen Konjunkturumfeldes eine deutliche Sparfähigkeit nachgewiesen werden. Weitere Ansatzpunkte bieten z.B. die Zahl der Vermögensübertragungen und die Betrachtung des Geldvermögens unterschiedlicher Anlageklassen. Im Weiteren wurde der qualitative Nutzen, bestehend aus der Kenntnis über die finanzielle Situation, sowie Abstimmung der persönlichen Ziele und der quantitative Nutzen in Form von Ausgabenminderung und Renditesteigerung näher erläutert.Auch für den Anbieter zeigt sich ein großer Nutzen der privaten Finanzplanung. Neben qualitativen Aspekten wie z.B. Kundenbindung oder Kompetenznachweis eines Finanzdienstleisters existieren quantitative Vorteile wie Ertragssteigerung, Erhöhung der Cross-Selling Quote oder die Marketingfunktion. Im dritten Teil der Arbeit wurde auf die einzelnen Teilbereiche der privaten Finanzplanung, dem Liquiditätsmanagement, Vorsorgemanagement und Vermögensmanagement näher eingegangen und die Arbeitsweise im jeweiligen Teilbereich erläutert. Aufgrund vieler Fehlentwicklungen in der Finanzberatung in Deutschland wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung entwickelt, welche ihre inhaltlichen Quellen in den wissenschaftlichen Disziplinen Ethikforschung, Qualitätsforschung, Verhaltensforschung, Verbraucherpolitik und der Rechtswissenschaft finden.Daraus haben sich in der Praxis Beratungsgrundsätze herausgebildet, die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung. Die Einhaltung dieser Grundsätze wird durch den Deutschen Verband Financial Planners e.V. überwacht und gelten als Pflichtlektüre für alle Berater, die eine qualitäts- und kundenorientierte Beratung durchführen wollen.Im weiteren Verlauf der Arbeit wurden ausgehend vom allgemeinen Problemlösungsprozess die einzelnen Phasen der Finanzplanung und deren Besonderheiten beschrieben. Im letzten Teil erfolgte die Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse in die Praxis. Anhand eines realen Kunden konnte vor allem der hohe Kundennutzen noch einmal deutlich unterstrichen werden.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Vorwort21.Einführung in die Thematik41.1Ausgangssituation und Problemstellung41.2Definitionen und Ab. 124 pp. Deutsch.
-
Strategien und Unternehmensimage beim CO2-Emissionhandel
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 383868740XISBN 13: 9783838687407
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Umweltwissenschaften, Note: 1,3, European Business School - Internationale Universität Schloß Reichartshausen Oestrich-Winkel (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Durch jüngste Umweltkatastrophen, sei es durch die Jahrhundertfluten an Oder und Elbe, verheerende Waldbrände in Europa oder schwerste Tornadoverwüstungen in der Karibik, scheint die Öffentlichkeit zunehmend sensibilisiert auf das Thema der globalen Erderwärmung und der damit einhergehenden Klimaveränderung zu blicken.Diese Entwicklung der zunehmenden Sensibilisierung wurde sicherlich grundlegend durch stärkere multilaterale Verhandlungen über einen Schutz der Umwelt und einem Beschluss zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen mit Beginn der neunziger Jahre geprägt.In den Brennpunkt des öffentlichen Interesses ist mit der russischen Ratifizierung des Kyoto-Protokolls dessen Inkrafttreten im Februar 2005 gerückt. Die Umsetzung zur Reduktion der Treibhausgase gibt seit der Verwirklichung des EU-weiten Emissionshandels mit Beginn des Jahres 2005 erstmals der CO2-Emission einen wirtschaftlichen Wert. Ziel der EU-Richtlinie ist es, den Ausstoß von CO2 unter das Niveau des Jahres 1990 zu senken. Um dies umzusetzen, wurde den verschiedenen Ländern der Union eine Reduktionsverpflichtung auferlegt, die diese innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu erfüllen haben. Innerhalb Deutschlands wird durch einen sog. Allokationsplan ein Großteil der Emissionsminderungen von Unternehmen bestimmter Industrien zu erbringen sein. Eine Strategie für die Erreichung der Emissionsverpflichtung des Unternehmens durch bestimmte, im Kyoto-Protokoll näher erläuterte und durch Richtlinien innerhalb der EU umzusetzende Mechanismen zustande zu bringen und so die Minderungsziele möglichst optimal zu erreichen, erscheint daher für die betroffenen Anlagenbetreiber eine Aufgabe von hoher Priorität zu sein.Hierbei spielen mehrere Aspekte eine Rolle, die von Unternehmen abgewogen werden müssen, um diesen Anforderungen aus Sicht der verschiedensten Stakeholder des Unternehmens Genüge zu leisten.Problemstellung:Die Einführung des EU-weiten Emissionshandels und die CO2-Reduktionsverpflichtung stellen die betroffenen Unternehmen vor große Herausforderungen. Es gilt, verschiedenste Möglichkeiten zur Erreichung des Reduktionsziels abzuwägen. So kann ein Unternehmen beispielsweise sowohl intern Emissionen senken, als auch Emissionsrechte kaufen und verkaufen.Die vorliegende Diplomarbeit Strategien und Unternehmensimage beim CO2-Emissionshandel zeigt Theorieansätze auf, inwiefern verschiedene Ansätze beim Emissionshandel gewählt werden können und inwieweit diese das Unternehmensimage beeinflussen können.Es wird sowohl ergründet, ob diese theoretischen Konzeptionen schon Eingang in die praktischen Überlegungen der betroffenen Unternehmen gefunden haben, als auch, welche Maßnahmen zur Kommunikation der getroffenen Strategien durchgeführt wurden und werden sollten.Diese Diplomarbeit soll Interessierten das komplexe System und die Wirkungsweise des Emissionshandels näher bringen und diesen einen Leitfaden für die evtl. Steigerung des Unternehmensimages durch den gezielten Einsatz von internen und externen Mechanismen zur Zielerreichung bieten. Gang der Untersuchung:Um die oben beschriebene Zielsetzung zu erreichen, wird in dieser Diplomarbeit die Theorie des Emissionshandels und des Unternehmensimages mit der unternehmerischen Praxis gekoppelt. Die Arbeit ist hierbei in sechs Abschnitte gegliedert.In der Einleitung wird dem Leser, ausgehend von der Problemstellung der Diplomarbeit, ein erster Einblick in die Relevanz und Aktualität des Emissionshandels aufgezeigt.In Gliederungspunkt 2 wird auf die Relevanz der CO2-Emissionsreduktion eingegangen und die Entwicklung der Klimasc. 296 pp. Deutsch.
-
Wertorientierte Unternehmensführung und Balanced Scorecard
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687744ISBN 13: 9783838687742
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,7, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Führen mit Kennzahlen ist der Traum vieler Manager und Controller . Aus diesem Traum ist in letzter Zeit allzu oft ein wahrer Alptraum geworden, da Controller eine Vorliebe für eine große Menge an Kennzahlen haben. Je mehr, desto besser aber wer kann aus diesem Zahlensalat noch ein Bild herauslesen Das derzeitige Umfeld eines Unternehmens zeichnet sich durch eine zunehmende Komplexität und Dynamik aus, die durch Unternehmenskonzentration, Globalisierung und einer immer schneller wachsenden informations- und kommunikationstechnologischen Vernetzung ausgelöst wurde. Aus diesem Grund muss sich das Top-Management der Unternehmen immer höheren Anforderungen stellen und sich neu ausrichten. Nicht nur in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, sondern auch im Handel muss mit verschärfter Preisaggressivität um jeden einzelnen Kunden gekämpft werden.Die traditionellen Berichts- und Kennzahlensysteme, die auf finanzielle Größen aufbauen, genügen nicht mehr den Ansprüchen des Managements. Die Kritik an diesen Systemen bezieht sich auf die Vergangenheitsorientierung, die fehlende Marktorientierung und die Vernachlässigung zukünftiger Leistungstreiber. Stattdessen gewinnt die strategische Ausrichtung und Planung immer mehr an Bedeutung. Um strategische Erfolgsfaktoren wie Lernfähigkeit und Flexibilisierung gezielt fördern zu können, ist die entsprechende Erfassung von Leistungspotenzialen eine grundlegende Voraussetzung.1990/91 stellten zwei Amerikaner ein neues Führungsinstrument vor die Balanced Scorecard. Mit dieser neuen Methode erhält das Management eines Unternehmens die Möglichkeit, ihr Unternehmen mit Hilfe von wenigen, aber entscheidenden Kennzahlen strategisch, flexibel und effektiv zu führen. Das Management wird somit mit dem Instrumentarium versorgt, das für den Wettbewerbserfolg notwendig ist.In der vorliegenden Arbeit wird die Balanced Scorecard im Vergleich zu Kennzahlensystemen und zu wertorientierten Unternehmensführung untersucht. Das Konzept wird dahingehend überprüft, ob es ein Controlling-Instrument, ein tatsächlich innovatives Unternehmensführungsinstrument oder lediglich nur ein weiteres Kennzahlensystem, bzw. nur eine Mischung aus herkömmlichen, traditionellen Managementkonzeptionen darstellt. Vielleicht liegen unterschiedliche Sichtweisen zum Bereich Controlling und den Aufgaben und Tätigkeitsfeldern eines Controllers vor, die das vorliegende Missverständnis begründen.Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel untergliedert. Die Einleitung beinhaltet sowohl die Problemstellung und die Zielsetzung, sowie die Vorgehensweise. Um die zuvor erwähnten Fragen im Laufe der Arbeit zu beantworten, sind zunächst im zweiten Kapitel eine Definition und die Grundlage von Controlling vorzufinden. Außerdem findet in diesem Kapitel eine allgemeine Betrachtung der Balanced Scorecard seinen Eingang.Das Grundmodell der Balanced Scorecard nach KAPLAN/NORTON wird im dritten Kapitel ausführlich behandelt, wobei hier auf die vier Perspektiven des Konzepts im Besonderen eingegangen und die Balanced Scorecard als Instrument des Performance Measurement vorgestellt und diskutiert wird. Darauf aufbauend werden kritisch die Grenzen der Balanced Scorecard aufgezeigt.Im darauf folgenden vierten Kapitel wird eine wesentliche Managementkonzeption der wertorientierten Unternehmensführung vorgestellt Shareholder Value Ansatz , um darauf aufbauend im späteren Kapitel eine vergleichende Analyse des Shareholder Value-Ansatzes und der Balanced Scorecard vorzunehmen.Im letzten Kapitel wird gezeigt, dass die Einbindung der Balanced Scorecard in das System der marktorientierten Unternehmenssteuerung vorran. 88 pp. Deutsch.
-
Kulturmarketing als Instrument zur Attraktivitätssteigerung von Städten
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687469ISBN 13: 9783838687469
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Sonstiges, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Städte und mit ihnen ihr kulturelles Angebot konkurrieren heutzutage mit einer Vielzahl von Freizeitangeboten, oft Hightech-Angeboten virtuellen Ursprungs, die mit Ihrer Modernität und Komplexität ihre Kunden begeistern und schon lange bestehende, aber dennoch zeitgemäße Einrichtungen und Angebote einer Stadt in den Schatten stellen.Einerseits gehören kulturelle Bildung und der Genuss von kulturellen Veranstaltungen zum guten Ton, andererseits wird in diesem Bereich bei Kürzungen der öffentlichen Gelder zuerst angesetzt und den entsprechenden Einrichtungen landesweit das Überleben erschwert. Wenn der finanzielle Aufwand für den Konsum von Kultur und kultureller Bildung immer weiter ansteigt, sinkt parallel die Zahl derer, die diesen Aufwand bewältigen können. Somit verliert der kulturelle Sektor potentielle und auch bestehende Kunden - zusätzlich zu den stützenden öffentlichen Geldern. Darüber hinaus trägt der in unserer Gesellschaft stattfindende Wertewandel dazu bei, dass Kultur- und Bildungsangebote sich gegen den immer größer werdenden Erlebniskonsum behaupten müssen. Hinzu kommt die Auslagerung von Grundversorgungsbetrieben aus den Kernstädten und dem wachsenden virtuellen Freizeitangebot, was zu einer Verödung der Innenstädte führt. Als Hauptgrund für die Krise wird der Markt genannt, der sich nur sträubend dem neuen Konsumverhalten anpasst und dass, obwohl die Menschen ( ) nach wie vor die lokale Identität suchen.Aufgrund sinkender Besucherzahlen kultureller Einrichtungen wird immer öfter gefordert, den veränderten Umweltgegebenheiten durch eine Orientierung am Marketingansatz Rechnung zu tragen. Vor dem Hintergrund sinkender Besucherresonanz auf kulturelle Angebote der Stadt Friedberg in Hessen verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, unter gegebenen Bedingungen eine eventuell bestehende Marketingorientierung öffentlicher Non-Profit-Kulturbetriebe in Friedberg zu prüfen und im zweiten Schritt ein effizientes Kulturmarketingkonzept zu implementieren. Im Fokus der Arbeit stehen dabei ausschließlich kulturelle Einrichtungen in Friedberg, insbesondere das Wetterau-Museum. Auf kulturelle Veranstaltungen wird nicht näher eingegangen, da bei diesen für eine Steigerung der Besucherzahlen in Friedberg weniger Handlungsbedarf besteht.Gang der Untersuchung:Die vorliegende Arbeit beruht sowohl auf theoretischen Ansätzen, in denen eine abstrakte Auseinandersetzung zur Erörterung des behandelten Sachverhalts erfolgt, als auch auf einem großen Teil empirischer Arbeit, um neue Erkenntnisse und aktuelle Lösungsmöglichkeiten für die gegenwärtige Problemstellung in kulturellen Einrichtungen Friedbergs zu gewinnen. Für eine sachgemäße und kompetente Bearbeitung des Themas sind grundlegende Kenntnisse über öffentliche Non-Profit-Kulturbetriebe nötig. Diese stehen im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Neben den nötigen Rahmenbedingungen und Intentionen eines Kulturbetriebes wird unter anderem auch erläutert, warum ein strategisches Leitbild für jede Kultureinrichtung unabdingbar ist.Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Begriff des Kulturmarketing und stellt die generelle Vereinbarkeit von Kultur und Marketing in Frage. Darüber hinaus erfolgt eine Erläuterung der einzelnen Bestandteile des Kulturmarketing sowie eine knappe Beschreibung des Weges von der kulturellen Einrichtung zum kulturellen Angebot.Vor dem Hintergrund niedriger Besucherzahlen des Wetterau-Museums stehen im Fokus des nächsten Kapitels deutsche Museen. Dabei wird im ersten Teil auf die finanzielle Förderung, Kulturausgaben und -einnahmen von Museen in Deutschland eingegangen, im zweiten Teil werden die Besucher von Museen eingehender betrachtet . 168 pp. Deutsch.
-
Gemeinschaftsrechtliche Kapitalverkehrsfreiheit und österreichisches Steuerrecht
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 3838687493ISBN 13: 9783838687490
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Handel und Distribution, Note: 2,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Rechtswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das nationale Recht und damit auch das nationale Steuerrecht ist von einem immer größer werdenden Einfluss des Europäischen Gemeinschaftsrechts gekennzeichnet. Insbesondere die im EG-Vertrag verankerten Grundfreiheiten schränken den Gestaltungsspielraum des nationalen Gesetzgebers ein, da nationale Regelungen nicht gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen dürfen.Die hier vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit einer dieser Grundfreiheiten, nämlich der Kapitalverkehrsfreiheit. Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung der Kapitalverkehrsfreiheit und einer Abgrenzung zu den anderen Grundfreiheiten wird das (für alle Grundfreiheiten wichtige) Beschränkungs- und Diskriminierungsverbot erläutert.Anschließend erfolgt eine Analyse der für das Steuerrecht wohl interessantesten und bedeutendsten Bestimmung im EG-Vertrag, der Steuerklausel. Diese erlaubt den Mitgliedstaaten der EU unter gewissen Voraussetzungen, die Kapitalverkehrsfreiheit zu beschränken. Am Ende des ersten Teils dieser Arbeit werden kurz die für Österreich wichtigsten Entscheidungen des EuGH zum Thema Kapitalverkehrsfreiheit und Steuerrecht dargestellt.Der zweite Teil (Kapitel IV) beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Kapitalverkehrsfreiheit auf das österreichische Steuerrecht. Anhand einiger ausgewählter Bereiche des Steuerrechts wird überprüft, ob nationale Vorschriften gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen. Unter anderem werden hier die Besteuerung von Zinsen und Dividenden, die Wegzugsbesteuerung, das Erbschaftssteuergesetz und die Besteuerung von Investmentfonds behandelt. Des Weiteren wird dargelegt, welche Änderungen bereits vorgenommen wurden, um eine Gemeinschaftsrechtskonformität der nationalen Vorschriften zu erreichen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbkürzungsverzeichnisIVI.Einleitung1II.Allgemeine Bedeutung des EG-Rechts für das nationale Steuerrecht21.Die Harmonisierung der Steuern in der EU22.Rahmenbedingungen des Gemeinschaftsrechts3III.Kapitalverkehrsfreiheit41.Rechtsentwicklung4 1.1Rechtslage gem Art 67ff EWGV41.2Kapitalverkehrs-Richtlinie 88/361/EWG41.3Änderungen durch den Vertrag von Maastricht52.Der Umfang der Kapitalverkehrsfreiheit72.1Kapitalverkehr und Zahlungsverkehr82.2Abgrenzung zur Niederlassungsfreiheit92.3Abgrenzung zur Warenverkehrsfreiheit112.4Abgrenzung zur Dienstleistungsfreiheit113.Beschränkungs- und Diskriminierungsverbot123.1Unterscheidung zwischen Diskriminierung und Beschränkung123.2Die Reichweite der Verbote133.3Rechtfertigung von Beschränkungen143.3.1Die Cassis -Doktrin153.3.2Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit154.Steuerrechtliche Aspekte in der Kapitalverkehrsfreiheit164.1Die Steuerklausel164.1.1Steuerklausel gem Art 58 Abs 1 lit a EG174.1.2Steuerklausel gem Art 58 Abs 1 lit b EG204.1.3Die Subsidiaritätsklausel214.1.4Einschränkung der Steuerklausel214.2Zwingende Gründe des Allgemeininteresses als Rechtfertigung für steuerliche Diskriminierung224.2.1Steuerliche Kohärenz244.2.2Gefahr der Steuerflucht254.2.3Herstellung der Wettbewerbsneutralität264.2.4Wirksame Steueraufsicht265.Die EUGH Rechtsprechung zum Konfliktfeld zwischen der Kapitalverkehrs- bzw Niederlassungsfreiheit und dem nationalen Steuerrecht275.1 Kommission/Frankreich ( avoir fiscal )275.2 Royal Bank of Scotland 295.3 Verkooijen 305.4 Schmid 325.5 Weidert und Paulus 335.6 Lenz 34IV.Auswirkungen der Kapitalverkehrsfreiheit auf das österreichische Steuerre. 84 pp. Deutsch.
-
Sportsponsoring bei der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland
Published by Diplom.De Mai 2005, 2005
ISBN 10: 383868754XISBN 13: 9783838687544
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Sport - Sportökonomie, Sportmanagement, Note: 1,0, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (4 Wirtschaftswissenschaften II), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Hervorgerufen durch den ständigen sozialen und ökonomischen Wandel unserer Gesellschaft unterliegt die Marketingkommunikation von Unternehmen einer stetigen Veränderung und Weiterentwicklung. Immer wieder werden neue Wege gesucht, um die Zielgruppen inhaltlich sowie emotional zu erreichen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei heutzutage auf der Kombination aller Instrumente des Kommunikationsmixes und deren vollständige Integration in die Kommunikationspolitik eines Unternehmens. So hat sich im Verlauf der letzten 20 Jahre das Sportsponsoring als eine erfolgreiche Form der Kommunikation etablieren können. Das Sportsponsoring in Verbindung mit einem weiteren Kommunikationsinstrument, den Events, stellt den inhaltlichen Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung dar, die im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftskommunikation an der FHTW Berlin vorgenommen wurde.Die Untersuchung gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Sponsoring-Forschung und setzt diesen in den Kontext einer konkreten Sport-Großveranstaltung. Ziel ist es, die Chancen und Risiken des Sponsorings der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 als einer gemeinsamen Kommunikationsplattform von Sportsponsoring und Events anhand der Unternehmen Adidas, MasterCard und Avaya aufzuzeigen.Im Rahmen der Arbeit wird dargelegt, was das Sportsponsoring und das Sponsoring eines Sport-Events so attraktiv gegenüber anderen Formen der Unternehmenskommunikation macht. Die Arbeit analysiert darüber hinaus die konkreten Zielstellungen dieser drei Unternehmen beim Sponsoring einer der weltgrößten Sportveranstaltungen und wägt Chancen aber auch mögliche Risiken ab.Das Interesse des Autors zu diesem Thema wurde aufgrund diverser Seminare im Verlauf des Studiengangs Wirtschaftskommunikation geweckt. Gleichzeitig bietet sich der Bereich des Sportsponsorings als eine interessante Option für die weitere berufliche Laufbahn an.Gang der Untersuchung:Nach dieser kurzen Einführung und Darlegung der Aufgabenstellung wendet sich das zweite Kapitel der Arbeit dem Thema Sponsoring zu. Anhand von Definitionen und Merkmalen werden das Sponsoring und seine Erscheinungsformen erklärt sowie deren Bedeutung anhand der Struktur des Sponsoringmarktes in Deutschland näher erläutert. Die anschließende Einordnung in die Unternehmenskommunikation zeigt die Zusammenhänge des Sponsorings aus Sicht des Marketing und der jeweiligen Sponsoringpartner. Weiterhin wird die Notwendigkeit der interinstrumentellen Integration des Sponsorings in die Kommunikationspolitik eines Unternehmens wie auch der intrainsrumentellen Integration der einzelnen Sponsoringaktivitäten dargestellt.Das dritte Kapitel widmet sich dem Sponsoring des Sports. Hier wird einleitend die wirtschaftliche Bedeutung des Sports und seine Einstufung als Kulturgut näher erläutert bevor die Entwicklung und Charakterisierung des Sportsponsorings dargestellt wird. Im Anschluss erfolgt die Erörterung der Motive, der Ziele und der Erscheinungsformen dieser Form des Sponsorings.Das vierte Kapitel beginnt mit der Charakterisierung von Events, hier speziell der Sport-Events, bevor dann näher auf die Geschichte der Fußball- Weltmeisterschaften allgemein sowie die wirtschaftliche und mediale Bedeutung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft eingegangen wird. Den Hauptteil dieses Kapitels stellen dann das Sponsoringsystem der FIFA und ihrer Partner sowie die Erläuterung der Konzepte der Firmen Adidas, MasterCard und Avaya dar, anhand dieser die Chancen- und Risiken der jeweiligen Sponsoringkonzepte aufgezeigt werden.Die Zusammenfassung der wichtigsten Details und deren kritische Bewertung sowie einige Überleg. 60 pp. Deutsch.